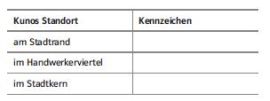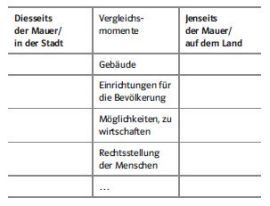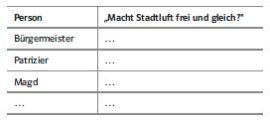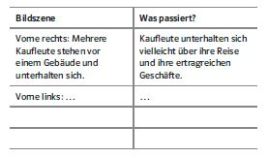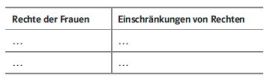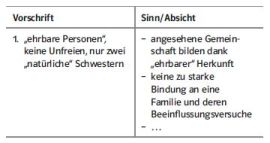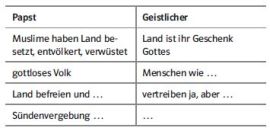baden-württemberg geschichte und geschehen
herausgeber michael sauer autorinnen und autoren jens breitschwerdt alexander chlup christine dzubiel michael epkenhans ursula fries bernhard geiger benedikt giesing sönke jaek georg langen josef memminger matti münch heinz niggemann peter offergeld michael sauer ernst klett verlag stuttgart leipzig geschichte und geschehen
umschlagbild zu sehen ist der ausschnitt einer mittelalterlichen ritterrüstung mit schwert zunächst bestand die ritterrüstung noch aus einem panzerhemd mit tausenden kleiner eiserner plättchen etwa seit mitte des jahrhunderts wurde der plattenpanzer oder harnisch getragen angepasst an die körperform des jeweiligen ritters die gesamte rüstung vom helm bis zum eisenschuh konnte bis zu kg wiegen ohne hilfe eines knappen gelangte kein ritter auf sein pferd auflage alle drucke dieser auflage sind unverändert und können im unterricht nebeneinander verwendet werden die letzte zahl bezeichnet das jahr des druckes das werk und seine teile sind urheberrechtlich geschützt. jede nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen fällen bedarf der vorherigen schriftlichen einwilligung des verlages. hinweis § 52 a urhg: weder das werk noch seine teile dürfen ohne eine solche einwilligung eingescannt und in ein netzwerk eingestellt werden. dies gilt auch für intranets von schulen und sonstigen bildungseinrichtungen. fotomechanische oder andere wiedergabeverfahren nur mit genehmigung des verlages © ernst klett verlag gmbh, stuttgart 2017. alle rechte vorbehalten. www.klett.de herausgeber : prof. dr. michael sauer, hannover autorinnen und autoren : jens breitschwerdt (stuttgart): s. 190–193, 195; alexander chlup (villingen): s. 64–67 christine dzubiel (bonn): s. 112–137; prof. dr. michael epkenhans (bardowick): s. 77, 104–109, 111; dr. ursula fries dortmund): 164, 166–171, 188–189, 194–195; bernhard geiger (esslingen am neckar): s. 100–103; dr. benedikt giesing düsseldorf): s. 112–137; sönke jaek (göttingen): s. 10, 20–38; georg langen (köln): s. 40–63, 74–75, 138–163; dr. josef memminger (regensburg): 11–19, 39; dr. matti münch (balingen): 76, 78–99, 110; dr. heinz niggemann (wetter): 165 172–187, 194–195; dr. peter offergeld (heinsberg): s. 68–73, 75; prof. dr. michael sauer (hannover): 75 redaktion : carsten loth, jana schumann herstellung : kerstin heisch assistenz : katja schnürpel gestaltung : petra michel, essen umschlaggestaltung : petra michel, essen illustrationen : sandy lohß, chemnitz; lutz-erich müller, leipzig; andrea naumann, aachen kartografien : mr-kartographie, gotha satz : kristin drechsler & anne lehmann, leipzig reproduktion : meyle+müller gmbh+co. kg, pforzheim druck : passavia druckservice gmbh & co. kg, passau printed in germany isbn 978-3-12-443220-9
inhaltsverzeichnis so löst du die aufgaben in diesem buch ausklappseiten so arbeitest du mit geschichte und geschehen europa im mittelalter zeitreise ins mittelalter zurück in eine finstere epoche woher nehmen könige und kaiser ihre macht kompetenztraining bildquellen analysieren wer betet wer schützt wer arbeitet kompetenztraining mit einem gruppenpuzzle lernen zum herrschen geboren der adel bete und arbeite immer nur arbeiten das leben der bauern wiederholen und anwenden die lebenswelt der mittelalterlichen stadt burger und baur scheydet nichts dann die maur macht stadtluft frei und gleich geschichte begegnen markttag wie im mittelalter handwerk hat goldenen boden kein handelsmann gedeiht zu hause kompetenztraining bauwerke analysieren jüdisches leben im mittelalter frauen in der stadt fenster zur welt die mongolen erschaffen ein weltreich fenster zur welt jerusalem und die kreuzzüge wiederholen und anwenden fakultative inhalte
wende zur neuzeit neue welten neue horizonte rückblick als fortschritt ein neues zeitalter beginnt der buchdruck der beginn eines neuen zeitalters erfahrung vor tradition vernunft vor glaube banken handel kaufleute prägend bis heute die folter macht die hexe geschichte begegnen die fasnetshexe fenster zur welt die expansion des osmanischen reiches eine zeitenwende für europa fenster zur welt für gold gott und gewürze die europäisierung der erde wiederholen und anwenden reformation und glaubenskonflikte in europa kompetenztraining ergebnisse präsentieren lernplakate und gallery walk ein mönch kritisiert die kirche und trifft den nerv der zeit der bauernkrieg ein berechtigter aufstand was ändert sich durch die reformation lässt sich trotz spaltung frieden bewahren jahre krieg aus glaubensgründen oder machtkalkül der weg zum territorialstaat wiederholen und anwenden der absolutismus am beispiel frankreichs macht und pracht oder der staat das bin ich geschichte begegnen schloss ludwigsburg das schwäbische versailles frankreich im absolutismus zwischen stillstand und fortschritt kompetenztraining herrscherbilder analysieren der merkantilismus frankreichs weg zum wohlstand möchtegern-„sonnenkönige oder der absolutismus im deutschen südwesten das zeitalter der aufklärung wiederholen und anwenden
die französische revolution frankreich in der krise kompetenztraining karikaturen analysieren freiheit gleichheit brüderlichkeit das alte regime wird gestürzt geschichte begegnen menschenrechte heute selbstverständlich oder immer noch missachtet die spaltung der revolutionäre und der streit um die monarchie kompetenztraining verfassungsschaubilder analysieren die schreckensherrschaft napoleon beendet die revolution fenster zur welt die amerikanische revolution vorbild für europa wiederholen und anwenden auf einen blick denkanstöße kapitelsteckbriefe glossar kompetenztraining begriffsglossar register bildquellennachweis literaturtipps ausklappseiten gesamtübersicht des online-materials letzte seite fakultative inhalte
so arbeitest du mit geschichte und geschehen geschichte analysieren und entdecken burger und baur scheydet nichts dann die maur die unterkapitel deines buches sind unterteilt in den informierenden verfassertext vt und einen materialteil gemeinsam lernen wirft eine frage auf und zeigt einen weg wie ihr diese gemeinsam analysieren und lösen könnt jedes unterkapitel beginnt mit einer historischen frage und einem einleitungstext der dir erklärt warum das thema wichtig ist am ende der unterkapitel befinden sich die aufgaben nach gefragt alle aufgaben verwenden operatoren die seiten geschichte begegnen zeigen dir wo dir geschichte im alltag begegnen kann in das thema einsteigen geschichte im alltag begegnen die kompetenzbox verrät dir was du lernen und analysieren wirst die anforderungsbereiche der verwendeten operatoren findest du hier
wiederholen und anwenden ermöglicht dir deine kompetenzen zu überprüfen im online-bereich kannst du das gelernte wiederholen und festigen das kompetenztraining zeigt dir wie du materialien und themen selbst erschließen kannst du trainierst arbeitstechniken gemeinsames lernen fachmethoden historisches denken die fenster zur welt ermöglichen dir einen ausblick auf andere weltgegenden kulturen und gesellschaften kompetenzen trainieren und festigen auf einen blick denkanstöße unterstützen dich bei der lösung von aufgaben kapitelsteckbriefe fassen die themen für dich noch einmal zusammen im glossar kompetenztraining findest du alle methodischen arbeitsschritte zum nachschlagen auf dem aufklappbaren vorsatz vorne und hinten wird dir erklärt wie du mit den operatoren arbeitest auf einigen seiten im buch findest du geschichte-und-geschehen-codes diese führen dich zu weiteren informationen im internet gib den code einfach in das suchfeld auf www.klett.de ein geschichtskarte veränderung des römisch-deutschen reiches a3u6z2 die geschichte der anderen symbole erklärung aufgaben mit denkanstößen verweis zu lösungshilfen ab aufgaben zum weiterdenken verweis auf verwandte themen themen verknüpfen geschichtserzählung zusatzmaterialien im online-bereich fakultative inhalte
gemeinsam lernen und nachgefragt unterbreiten sowohl niveaulernwegsals auch neigungsdifferenzierende angebote so gelangen alle zum gleichen ziel im unterricht differenzieren neigungsdifferenzierung unterrichtsvorschläge in der gemeinsam-lernen-box ermöglichen differenzierung in vielfältiger weise in kooperativen lernformen wie partnerarbeit gruppenpuzzle oder think-pair-share können sich alle ihren fähigkeiten und ihren interessen gemäß einbringen burger und baur scheydet nichts dann die maur
lernwegsdifferenzierung in jedem kapitel findet sich eine lernwegsdifferenzierende aufgabe hier kann jeder seinen eigenen erarbeitungsbzw präsentationsweg wählen niveaudifferenzierung aufgaben mit lösungshilfen zwei bis drei ausgewählten aufgaben pro unterkapitel sind sogenannte denkanstöße beigefügt diese denkanstöße geben tipps und hinweise zur lösung der aufgabe sie erleichtern es jenen die unterstützung brauchen zu einem fundierten ergebnis zu kommen aufgaben zum weiterdenken in jedem unterkapitel gibt es eine aufgabe zum weiterdenken diese geht über den inhaltlichen schwerpunkt des unterkapitels hinaus und richtet sich an alle die sich intensiver mit dem thema beschäftigen möchten führe als kaufmannsfrau oder als kaufmann besucher durch dein haus d2 formuliere dazu in einem ersten schritt mögliche fragen der besucher schreibe dann deine ausführungen auf als kaufmann möchtest du dass dein sohn später das geschäft übernimmt erläutere ihm was auf ihn zukommt und wie er sich darauf vor bereiten kann vt stell dir vor du bist ein hansekaufmann du unterhältst dich im hafen von bremen mit einem händler der keiner kaufmannsgilde angehört erkläre ihm worin der vorteil besteht dass du hansekaufmann bist vt du kommst um 1500 das erste mal an den hamburger hafen q1 formuliere deine eindrücke indem du aus einer der drei folgenden aufgaben wählst schreibe einen brief nach hause beginne so heute morgen war ich im hafen ihr glaubt nicht was ich da alles gesehen habe gestalte in dialogform ein gespräch über das hafengeschehen zwischen den beiden personen im roten und grünen gewand am unteren bildrand stelle auf einem werbeplakat den hamburger hafen vor jahren dar arbeite dabei mit sprachlichen und mit grafi schen elementen analysiere die beschwerden gegen die hanse antworte als norwegischer händler und als hansekaufmann darauf q2 stelle am beispiel von q3 dar wie sich kaufl eute vor betrug schützten du sollst fässer salz von köln nach moskau liefern ein fuhrwerk schafft am tag ungefähr km eine hansekogge etwa km entscheide wie das salz am günstigsten zu den abnehmern gelangt überlege auch welche russischen waren du im raum köln verkaufen könntest d1 erörtere positive und negative seiten eines kaufmannsdaseins im mittelalter nachgefragt afb ii afb ii q3 qualitätssicherung in der hanse aus einem beschluss der lübecker hanseversammlung im juni 1375 ferner kam die klage an die städte wegen der teerund aschetonnen man fälsche die mache den boden und den deckel allzu dick und man fülle erde hinein in dieser sache soll man an preußen stettin kolberg und goland briefe senden damit jeder sich in acht nehme denn wenn man nach dem nächsten st martinstag solche ware ndet so soll als fälschung darüber gerichtet werden diesen beschluß soll jede stadt ihren nachbarn mitteilen ferner soll der vogt auf schonen den seinen verkünden daß sie ihren hering so in die tonnen einsalzen daß er an beiden böden und in der mitte gleich gut sei und daß man keine …minderwertigen heringe zwischen die guten packe zit. nach johannes bühler, bauern, bürger und hansa, leipzig 1929, s. 296 f d3 rekonstruktionsmodell einer kogge zwischen dem und jahrhundert zählte dieses einmastige segelschiff zum wichtigsten transportmittel der hanse die kogge war ca bis meter lang und fünf bis acht meter breit dich in die rolle eines der sich in freiburg anerkläre einem geschäftsgründe q3 vergleiche kunos beobachtungen mit q4 was fi ndest du wieder was nicht woran könnte das liegen im mittelalter hieß es burger und baur scheydet nichts dann die maur erörtere ob der ausspruch zutrifft begib dich auf spurensuche in deiner stadt und stelle eine ähnliche übersicht wie für freiburg zu sammen q4 präsentiere das ergebnis in deiner klasse afb ii afb iii die denkanstöße befinden sich am ende des buches
1210 1140 1070 1096 in den städten am rhein kommt es zu juden verfolgungen 1096–1099 erster kreuzzug nach palästina frühes jahrhundert der baustil der gotik löst zu neh mend den romanischen stil ab 1000 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt dem mittelalter bist du vielleicht schon einmal auf einem historischen mittelaltermarkt begegnet dort vermitteln gaukler und krämer ein bild vom leben in dieser zeit doch hat mittelalterliches leben wirklich so ausgesehen anders als heute lebten zu dieser zeit wenig menschen in den städten auch wenn viele gern dorthin gezogen wären was machte das städtische leben so attraktiv und den zuzug schwierig weshalb lebte man dort frei aber überhaupt nicht gleich 1120 freiburg im breisgau wird vom herzog von zähringen gegründet ende jahrhundert erste stadträte werden gebildet
1420 1350 1280 d1 mittelaltermarkt“ auf schloss burg an der wupper foto 2010 1358 die hanse ist als kaufmannsbund bezeugt spätes jahrhundert die handwerksmeister der zünfte verlangen die aufnahme in die stadträte am ende dieses kapitels weißt und kannst du folgendes kompetenzen sachkompetenz du kannst folgende begriffe erklären stadtluft macht frei bürger markt zunft rat schutzprivileg du kannst die merkmale einer mittelalterlichen stadt benennen du kannst die bedeutung von kaufleuten und handwerkern für das wirtschaftsleben der mittelalterlichen stadt erläutern du kannst die mittelalterlichen handelsbeziehungen zwischen europa und asien beschreiben methodenkompetenz du kannst ein historisches bauwerk analysieren fragekompetenz du kannst die frage inwiefern im mittelalter stadtluft frei machte nachvollziehen reflexionskompetenz du kannst beurteilen welche stellung die unterschiedlichen personengruppen in der mittelalterlichen stadtgesellschaft einnahmen du kannst ursachen und folgen der kreuzzüge analysieren und bewerten orientierungskompetenz du kannst die lebenswelt der mittelalterlichen stadt mit der gegenwart vergleichen und bewerten 1280 das mongolische reich erreicht seine größte ausdehnung 1291 ende der europäischen herrschaft in palästina regensburg regensburg regensburg regensburg regensburg regensburg passau wien wien wien wien wien wien konstanz konstanz konstanz konstanz leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig leipzig stuttgart stuttgart stuttgart stuttgart stuttgart nordse st see bremen hamburg münster goslar magdeburg köln trier aachen fulda erfurt frankfurt mainz speyer prag regensburg passau wien konstanz amsterdam lübeck rostock berlin brandenburg danzig schwerin dresden leipzig münchen soest paderborn straßburg stuttgart worms nordse der st see ein waldfreies gebiet um landwirtschaft zum teil siedlungsfläche wald um von bis 1300 gerodete waldflächen dann landwirtschaft zum teil siedlungsfläche um 1300 erhaltene waldflächen heide von bis 1300 wenig verändert moor von bis 1300 wenig verändert stadt römische gründung siedlung um handelsplatz bischofssitz kloster burg späteres stadtrecht stadt gründung nach landnutzung und vegetation 900–1300 siedlungen km klett bremen hamburg münster goslar magdeburg köln trier aachen fulda erfurt frankfurt mainz speyer prag regensburg passau wien konstanz amsterdam lübeck rostock berlin brandenburg danzig schwerin dresden leipzig münchen soest paderborn straßburg stuttgart worms nordse der st see ein waldfreies gebiet um landwirtschaft zum teil siedlungsfläche wald um von bis 1300 gerodete waldflächen dann landwirtschaft zum teil siedlungsfläche um 1300 erhaltene waldflächen heide von bis 1300 wenig verändert moor von bis 1300 wenig verändert stadt römische gründung siedlung um handelsplatz bischofssitz kloster burg späteres stadtrecht stadt gründung nach landnutzung und vegetation 900–1300 siedlungen km klett bremen hamburg münster goslar magdeburg köln trier aachen fulda erfurt frankfurt mainz speyer prag regensburg passau wien konstanz amsterdam berlin brandenburg schwerin dresden leipzig münchen soest paderborn straßburg stuttgart worms der ein wald um von bis 1300 gerodete waldflächen dann landwirtschaft zum teil siedlungsfläche um 1300 erhaltene waldflächen heide von bis 1300 wenig verändert moor von bis 1300 wenig verändert stadt römische gründung siedlung um handelsplatz bischofssitz kloster burg späteres stadtrecht stadt gründung nach siedlungen km landnutzung und vegetation 900–1300
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt burger und baur scheydet nichts dann die maur im mittelalter lebten die meisten menschen als bauern auf dem land im schutze der stadtmauern arbeiten und leben zu dürfen war nur wenigen vorbehalten folge kuno einem jungen dorfbewohner bei seiner entdeckungstour durch eine mittelalterliche stadt mauern und handwerkergassen schon von weitem erkennt kuno die kirchtürme der stadt beim näherkommen erscheint sie ihm wie eine große burg die von mauern mit hohen türmen und einem breiten graben umgeben ist über eine zug brücke gelangt er an das stadttor der wachposten lässt ihn passieren jetzt sieht er gärten frei herumlaufende schweine und andere tiere die menschen hier am stadtrand wirken ärmlich und auch die niedrigen eingeschossigen holzhäuser erinnern ihn sehr an sein dorf kuno ist verunsichert wo sind denn nur die prachtvollen fassaden von denen er gehört hat je mehr sich kuno dem stadtzentrum nähert desto enger werden die gassen nun sieht er auch erste fachwerkhäuser die sogar mehrere stockwerke haben schmiede arbeiten in den werkstätten und davor auf der straße eine gasse weiter findet er nur schuhmacher in der nächsten nur bäcker in ihren häusern befinden sich zu ebener erde die läden und werkstätten aus den wohnungen im ersten geschoss hört er kindergeschrei zu einem der darüberliegenden dachböden werden mit einem flaschenzug waren hochgezogen gern würde er da genauer hinschauen doch er muss achtgeben auf den weg schlammig ist er und auch schmutzig wegen der vielen herumliegenden abfälle kirchen und kaufmannshäuser endlich hat kuno die schneidergasse gefunden hier lebt und arbeitet sein onkel den er besuchen will sein vetter jakob zeigt ihm noch mehr von der stadt und führt ihn zum herzstück dem markt platz hier herrscht ein wildes treiben bauern bieten lebensmittel an handwerker verkaufen ihre waren und städtische aufseher überwachen das geschehen rundherum stehen stattliche häuser aus stein mit bunten verzierten fassaden und fenstern aus glas durch die großen tore gehen vornehm gekleidete bürger aus und ein hier wohnen unsere reichsten bürger die weitgereisten kaufleute und auch der apotheker da drüben im rathaus kümmern sich der stadtrat und die bürgermeister um unsere stadt erklärt jakob hast du schon den marktbrunnen entdeckt der stadtrat hat ihn letztes jahr stadt von althochdeutsch stat ort stelle kennzeichen von städten sind eine gewisse größe eine hohe dichte der bebauung und eine besondere bedeutung von handel kultur sowie verwaltung gemeinsam lernen mittelalterliche spuren in unserer stadt organisiert zu diesem thema in eurer klasse ein gruppenpuzzle arbeit in stammgruppen teilt eure klasse zunächst in stammgruppen mit je vier schülern auf einigt euch wer von euch in welche expertengruppe geht arbeit in expertengruppen gruppe entstehung der städtischen selbstverwaltung 42–47 gruppe bedeutung von handwerk und zünften 50–51 gruppe bedeutung des handels 52–55 gruppe frauen in der stadt 62–63 arbeit in stammgruppen teilt eure ergebnisse in der stammgruppe und bereitet zu euren arbeitsergebnissen einen stadtrundgang in einer nahe gelegenen stadt vor haltet dann vor ort einen kleinen vortrag am rathaus gruppe in der färbergasse usw noch ein tipp wie es in eurer stadt genau war findet ihr über fachbücher oder eine internetrecherche heraus vielleicht gibt es darin abbildungen von heute nicht mehr vorhandenen gebäuden die ihr vor ort zeigen könnt gruppenpuzzle
bauen lassen und jetzt haben wir alle frisches wasser ehrfürchtig bestaunt kuno die große und besonders prachtvolle hauptkirche mehrere kleinere waren ihm vorher schon aufgefallen jakob lenkt ihn ab sieh mal da drüben den mann am pranger jeder soll sehen dass er sich etwas hat zuschulden kommen lassen der rat und die herren bürger meister sorgen für ordnung und bestrafen die übeltäter wie gern würde kuno mit jakob tauschen die stadt gefällt ihm hier möchte er selbst leben städte – ein erfolgsmodell seit dem jahrhundert hatte die zahl der stadtgründungen zugenommen die bevölkerungszahl war gestiegen und die bauern erzeugten überschüsse an nahrungsmitteln die bewohner der mittelalterlichen städte konnten sich deshalb auf handwerk handel und verwaltungsaufgaben konzentrieren besonders wichtig war dass märkte abgehalten wurden dafür benötigte man allerdings eine genehmigung des landesherrn nach und nach übertrug dieser seinen städten einige privilegien vorrechte wie das marktrecht oder das recht eigene münzen zu prägen markt ursprünglich versteht man darunter den ort an dem waren angeboten und verkauft werden namen wie alter markt oder salzmarkt erinnern noch heute daran pranger darunter versteht man eine säule oder vergleichbare vorrichtung an der ein verurteilter festgebunden und öffentlich vorgeführt wurde die damit verbundene schande machte die eigentliche bestrafung aus d1 ursprünge mittelalterlicher städte neben den gründungen durch landesherren bildmitte erkennst du auf dieser rekonstruktionszeichnung auch andere ursprünge
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt nenne die wichtigsten kennzeichen einer mittelalterlichen stadt folge kunos weg durch die stadt in mittelalterlichen städten existierten in der regel weder straßennamen noch hausnummern stelle an drei konkreten beispielen dar wie man trotzdem als fremder einen stadtbewohner finden konnte sofern man etwas über ihn wusste arbeite mithilfe von d1 heraus welche unterschiedlichen ursprünge mittel alterliche städte haben können finde heraus was auf deine heimatstadt zutrifft arbeite heraus welche ziele der herzog mit seiner ordnung für landshut q2 verfolgte nachgefragt q2 markt- und gewerbeordnung von landshut sie wurde 1256 von stadtherr herzog heinrich xiii erlassen wir verbieten schwerter und dolche innerhalb der stadt zu tragen und sooft leute ge troffen werden die schwerter tragen sooft werden sie der stadt schillinge und dem richter 60 pfennige zahlen wenn einer der ein schwert trägt kein geld besitzt wird ihm die hand abgeschlagen werden wir verordnen 2½ pfund rindfleisch für einen schilling zu verkaufen und ebenso viel hammelfleisch und drei pfund ziegenfleisch die leute die es anders machen werden der stadt schillinge und dem richter pfennige zahlen wir verordnen daß kein kauf außerhalb des öffentlichen marktes stattfindet was die leute betrifft die der stadt waren zuführen lotterbuben in jeder art fahrende schüler studenten auf dem weg zu ihrer universität mit langem haar halten wir fern die leute die sie über eine nacht hinaus beherbergen verurteilen wir zu pfund zit nach monumenta germaniae historica mgh ll constitutiones ii nr übers von dr uwe horst anm verf pfund entsprach schillingen oder pfennigen q3 freiburg im breisgau wird gegründet herzog konrad von zähringen regelt 1120 in einer urkunde nachdem ich kaufleute der umgebung zusammengerufen habe habe ich beschlossen diesen markt zu gründen und einzurichten jedem kaufmann habe ich ein grundstück zum bau eines eigenen hauses gegeben und bestimmt daß von jedem dieser hausgrundstücke jährlich am martinstag mir und meinen nachfolgern ein schilling zins gezahlt werden soll ich verspreche all jenen die zu meinem markt kommen frieden und schutz wenn einer in diesem bereich beraubt wird und er nennt den räuber soll er den schaden ersetzt bekommen wenn einer meiner bürger stirbt soll seine frau mit seinen kindern alles besitzen ohne jeden einspruch was er hinterlassen hat allen kaufleuten der stadt erlasse ich den zoll meinen bürgern will ich keinen anderen vogt vertreter des herzogs in der stadt oder priester geben außer dem welchen sie selbst gewählt haben wenn ein streit oder rechtsfall entsteht soll nicht von mir oder meinen richtern darüber entschieden werden sondern nach gewohnheit und recht aller kaufleute wie sie besonders in köln geübt werden jede frau wird dem mann gleichgesetzt und umgekehrt wenn der mangel am notwendigsten jemanden dazu zwingt darf er seinen besitz verkaufen an wen er will jeder der in diese stadt kommt darf sich hier frei niederlassen wenn es nicht der leibeigene irgendeines herren ist und diesen auch anerkennt als seinen herrn wenn aber ein leibeigener seinen herrn verleugnet kann der herr mit sieben zeugen beweisen daß der leibeigene ihm gehört wer aber über jahr und tag in der stadt gewohnt hat ohne daß irgendein herr ihn als seinen leibeigenen gefordert hat der genieße von da an sicher die freiheit bürger dieser stadt ist wer ein freies erbeigentum in der höhe von mindestens einer mark wert besitzt zit nach dieter starke herrschaft und genossenschaft im mittelalter stuttgart 1971
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 1
Liste zunächst alle Kennzeichen, die du der Geschichtserzählung entnehmen kannst, auf.
Trage sie dann in die folgende Tabelle ein.
q4 spurensuche in freiburg in alten städten trifft man bis heute auf spuren des mittelalters allerdings haben fast immer nur die vorzeigebauwerke überdauert die behausungen der armen und die schlammigen straßen sind längst nicht mehr zu sehen so ist es auch in freiburg das hier als beispiel dient münster eine hauptkirche gehörte zu jeder stadt in freiburg ist es das münster unserer lieben frau von etwa 1200 bis 1513 wurde daran gebaut der hohe gotische turm wurde 1330 fertig gestellt seinerzeit war der münsterturm das höchste gebäude europas versetze dich in die rolle eines kaufmanns der sich in freiburg angesiedelt hat erkläre einem geschäftspartner deine gründe q3 vergleiche kunos beobachtungen mit q4 was findest du wieder was nicht woran könnte das liegen im mittelalter hieß es burger und baur scheydet nichts dann die maur erörtere ob der ausspruch zutrifft begib dich auf spurensuche in deiner stadt und stelle eine ähnliche übersicht wie für freiburg zu sammen q4 präsentiere das ergebnis in deiner klasse afb afb ii afb iii martinstor die um 1120 begonnene stadtmauer bot schutz stadttore ermöglichten den durchgang das in form eines turmes gestaltete martinstor passte sich mit ursprüng lich der höhe der stadtmauer an 1901 erhielt das tor seine heutige rund dreifache höhe gerichtslaube das gebäude diente ab dem frühen jahrhundert als tagungsort des stadtrats das obergeschoss mit dem ratssaal war ursprünglich in fachwerkbauweise erbaut und hat seine heutige form im jahrhundert erhalten im erdgeschoss tagte das städtische gericht wegen starker beschädigungen im zweiten weltkrieg musste das gebäude in großen teilen wieder aufgebaut werden kaufhaus das auf das jahrhundert zurückgehende kaufhaus erhielt in der ersten hälfte des jahrhunderts seine heutige form eine halle im erdgeschoss ein saal im obergeschoss und lagerflächen im dachgeschoss dien ten dem städtischen handel
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 5
Du musst in deiner Rolle herausarbeiten, was für dich als Kaufmann vorteilhaft daran ist, in Freiburg zu leben. Welche Vorteile waren offenbar nicht selbstverständlich? Verwende dafür Formulierungen wie „der Herzog sichert etwas ausdrücklich zu“ oder verwende das Verb „dürfen“ bzw. „ermöglichen“, um die Vorzüge des Lebens in Freiburg herauszustellen.
Drucken
Verstehen
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt macht stadtluft frei und gleich wir denken bei stadtluft an auspuffgase und andere umweltprobleme ganz anders im mittelalter da lauerten in der natur gefahren die stadt aber bot sicher heit und roch gleichsam nach freiheit und chancen zumindest für einige regieren und zusammenleben stadtherr war ursprünglich der könig später auch bischöfe herzöge oder grafen seit dem jahrhundert erstritten die bürger die einrichtung eines stadtrates und wählten aus ihren reihen einen bürgermeister zu dessen aufgaben gehörten der vorsitz im städtischen gericht und die führung der bewaffneten im kriegsfall der stadtrat erließ anordnungen über die höhe der steuern manchmal erstritten stadtrat und die ihn anführenden patrizier reiche kaufmannsfamilien nur einzelne dieser rechte andere erkämpften mit gewalt die selbstverwaltung und vertrieben den stadtherrn auf diese weise sicherten sie die freiheit der stadt vor allem aber sich selbst eine mächtige stellung nicht alle stadtbewohner waren bürger das bürgerrecht wurde nur vermögenden verliehen handwerkergesellen oder mägde konnten das bürgerrecht also nicht erwerben manche tätigkeiten galten als unehrenhaft die von spielleuten oder die des henkers auf diese stadtbewohner sah man herab eines jedoch war allen städtern gemeinsam stadtluft machte frei denn nach der frist von ein(em jahr und ein(em tag verlor der grundherr seinen anspruch auf eine in die stadt geflohene person sie war damit also frei bürger/bürgerrecht ein bürger schwor seiner stadt mit dem bürgereid treue und gehorsam bei rechtsstreitigkeiten konnte er städtische gerichte anrufen oder den rat um hilfe bitten q1 tanzfest in augsburg gemälde aus dem jahrhundert q2 fahrendes volk holzschnitt um 1450 das paar hat alles bei sich was es besitzt
q3 stadtsiegel von lübeck, 1256 die beiden männer in der kogge erheben die hand zum schwur das symbol der vereinigung zur freien bürgergemeinde q4 das siegel der stadt freiburg, ca. 1245 das siegel zeigt eine stadtmauer sowie links und rechts des turms hornbläser vermutlich als zeichen städtischer unabhängig keit q5 das siegel der stadt köln, 1268 auf diesem siegel umgibt den heiligen petrus gotisches maßwerk es verweist auf den dom beschreibe die kleidung der tanzenden q1 erkläre um welche bevölkerungsgruppe es sich handelt und nenne gründe q1 vergleiche dann mit den personen in q2 fasse zusammen was ein zukünftiger bürger herfords versprechen musste q7 erkläre mithilfe der aussage in q6 warum solche zusagen von einem künftigen herforder bürger erwartet wurden in ihren siegeln stellen die städte ihr selbstverständnis dar erläutere in diesem sinne das selbstverständnis lübecks freiburgs und kölns vt q3 q5 macht stadtluft frei und gleich antworte darauf als bürgermeister als patrizier als dessen magd als tagelöhner als bettler ihr könnt dies auch verteilt vorbereiten und als streitgespräch auf dem marktplatz umsetzen vt q1 q2 nachgefragt afb afb ii afb iii q6 der stede beste vasticheit im rechtsbuch der stadt herford das um 1370 entstand ist eine fahne in einer bilddarstellung miniatur so beschriftet myne leven borghere weset eyndrechtich wente der borgere eyndrechticheyr is der stede beste vasticheit übersetzung ins hochdeutsche oh meine lieben bürger seid einträchtig denn die eintracht der bürger ist die größte stärke der städte rechtsbuch der stadt herford kommentarband theodor helmertcorvey hrsg bielefeld verlag für regionalgeschichte 1989 übers von wolfgang fedders ulrich weber q7 wie man bürger aufnehmen soll regelung aus herford wo die vorsteherin äbtissin des stifts klosters die stadtherrschaft innehatte dann soll er folgendermaßen schwören daß ich dem stift herford und der stadt herford und den bürgern zu herford so treu und zuverlässig sein soll wie ein bürger von rechts wegen sein soll daß mir gott und die heiligen helfen mögen bevor er diesen eid schwört so frage man ihn ob er eigenhörig unfrei sei oder in todfehde verwickelt dann soll ihm das bürgerrecht nicht helfen spricht er dann er sei nicht eigenhörig sondern frei so soll man es ihm mit recht glauben rechtsbuch der stadt herford kommentarband theodor helmertcorvey hrsg bielefeld verlag für regionalgeschichte 1989 übers von wolfgang fedders ulrich weber städtischer unabhängig
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 5
Fertige eine kleine Skizze an, in der du den Siegelabdruck in Teile „zerlegst“. Überlege dann, welche Aussage jeder Teil jeweils hat, und setze diese Aussagen schließlich zusammen.
Drucken
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 6
Vorgegeben sind zwei Kriterien: Freiheit und Gleichheit. Stelle für jede genannte Person gegenüber, ob und warum sie frei oder nicht frei, gleich oder nicht gleich ist:
Formuliere dann deine Ergebnisse bspw. in Form eines Briefes.
Drucken
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt markttag wie im mittelalter mittelalter ist in das hört und liest man immer öfter ritterturniere oder mittelaltermärkte locken viele menschen an und ziehen sie in ihren bann doch wie mittelalterlich sind solche märkte wirklich helfen sie uns dabei ein richtiges bild von dieser epoche zu bekommen mach dir mithilfe der folgenden materialien selbst ein bild d1 mittelaltermarkt auf schloss burg d2 interview mit einem veranstalter gregor ahlmann wissenschaftlicher referent beim schlossbauverein schloss burg im bergischen land veranstaltet mittelaltermärkte die jährlich von rund menschen besucht werden worin besteht ihre motivation mittelaltermärkte zu veranstalten wir möchten mit unseren veranstaltungen zwar geld verdienen das war auch im mittelalter nicht anders vor allem aber möchten wir in ergänzung zu unserem museum in der burg das mittelalter durch viele eindrücke also ganz eindrücklich“ – den besuchern vermitteln bilder vom dunklen mittelalter mit brutalen rittern und armen bauern existieren in den köpfen vieler menschen das ist zwar nicht ganz falsch aber unsere märkte zeigen wie bunt und vielfältig das mittelalter eben auch gewesen ist was macht ihren markt interessant da ist zum einen das umfeld keine grüne wiese sondern eine burganlage ist unsere kulisse unser größtes pfund ist das gebäude und ambiente zieht sowohl anbieter wie auch besucher aber wir achten auch auf viel authentizität echtheit so beim warenangebot und bei den materialien aus denen die stände erbaut werden das gilt auch für die bei besuchern so beliebten musikdarbietungen außer mönchsgesängen wurde seinerzeit nichts aufgeschrieben und auch deshalb spielen viele musikgruppen heute recht rockig wirkende stücke unsere musik soll stimmig sein instrumente ohne verstärker so wie man sie im mittelalter benutzte gehören dazu wenn dann am ende die besucher nach hause gehen und lust auf mittelalter bekommen haben dann haben wir unser ziel erreicht und dürfen sie bei einer unserer nächsten veranstaltungen hoffentlich auch wieder begrüßen zusammengestellt von langen auf basis des am august 2014 mit ahlmann geführten interviews
geschichte begegnen hast du selbst schon einen mittelaltermarkt besucht schildere deine eindrücke und erfahrungen nenne aspekte die für die durchführung von mittelaltermärkten sprechen vt d1 d5 vergleiche die konzepte der märkte auf schloss burg d1 und des mittelalter lich phantasie spectaculum d3 beurteile die beweggründe der auf den märkten tätigen händler am beispiel der töpfersfrau d4 d5 erörtert gemeinsam ob man mit dem besuch eines mittelaltermarktes eine zeitreise ins mittelalter unternehmen kann überprüfe ob du selbst gern als akteur bei einem solchen markt mitwirken würdest und tausche dich darüber mit deinem banknachbarn aus nachgefragt d3 wir setzen auf phantasie unter dem namen mittelalterlich phantasie spectaculum finden deutschlandweit rund veranstaltungen an wochenenden statt die von mehreren hunderttausend menschen besucht werden der gründer schreibt auf seiner homepage wir präsentieren eine noch fantasie vollere lebendigere quirligere buntere und facettenreichere mittelalterliche erlebniswelt denn wir wollen nicht mit reinen oft langweili gen mittelalterlichen verkaufsmärkten oder schlimmer noch mit so genannten authentischen langweilermittelalterlager veranstaltungen verglichen oder in verbindung gebracht werden denn wir verstehen unsere festivals als eine einmalige lebendige und fantastische erlebniswelt wir haben nicht den anspruch authentisch zu sein denn authentizität ist unserer meinung nach nur ein schlagwort für die besserwisser in der mittelalterszene es gibt nun mal außerhalb der museen keine originalplanen originalholz original wägen leder und accessoires mehr und es gibt auch keine 100%igen aufzeichnungen wie ein mittelalterliches fest genau ausgesehen haben könnte es gibt nur die eine tat sache dass wenn man den überlieferungen folgen würde eine authentische veranstaltung wegen der darzustellenden armut dem schmutz dem gestank der krankheiten etc mit hundertprozentiger sicherheit nicht dem anspruch bester unterhaltung genügen würde wir beschränken uns deshalb auf das[ was uns vom mittelalter noch geblieben ist die erinnerung an eine hochinteressante zeit voller leben mythen und abenteuer wir sind nicht authentisch sondern phantastisch auf http://spectaculum.de/ueber/vaname/ zugriff 29.07.2014 d5 die töpfersfrau, eine händlerin eine anbieterin auf mittelaltermärkten berichtet ich verkaufe selbstgefertigte töpfer waren wie becher die mein mann nach einem seit der römerzeit benutzten verfahren herstellt nur eines hat sich geändert die drehscheibe treibt ein elektromotor an weil tagelanges drehen der scheibe mit den füßen zu schmerzhaft ist unsere mitwirkung bei mittelaltermärkten begann damit dass vor fast zehn jahren der veranstalter eines mittelalterlichen weihnachtsmarktes angefragt hat ob unsere töpferei becher für den getränkestand herstellen könnte da haben wir zugesagt und auch gleich unseren ersten stand auf einem markt aufgebaut heute sind wir pro jahr auf etwa dreißig märkten vertreten unser komplettes geschäft beruht inzwischen auf diesen märkten am stand trage ich das gewand einer edeldame die mit einem ritter verheiratet ist dass die töpfers frau im mittelalter ganz anders gekleidet gewesen wäre stört mich nicht ich möchte an unserem verkaufsstand gern einen guten eindruck machen einen namen habe ich mir auch gegeben ich nenne mich andara zu grenzau zusammengestellt von langen auf basis des am august 2014 mit grundmann geführten interviews afb afb ii afb iii d4 andara zu grenzau die töpfersfrau foto 2014
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt handwerk hat goldenen boden so sagt es ein altes sprichwort traf dies auch auf das handwerk in den mittelalterlichen städten zu wie arbeiteten lebten und organisierten sich die handwerker damals und was bedeutete es eigentlich ein zünftiger handwerker zu sein städte – zentren des handwerks mehr als die hälfte der stadtbewohner verdiente ihren lebensunterhalt im handwerk auf dem land wurden kleidung und gebrauchsgegenstände von den bauern möglichst selbst hergestellt weil das am preis wertesten war wohlhabende städter hingegen ließen ihre kleidungsstücke bei spezialisten wie gewandschneidern kürsch nern und schuhmachern anfertigen die schuhmacher kauften ihrerseits das leder von gerbern und die wiederum waren kunden bei den färbern mit den steigenden ansprüchen ihrer auftraggeber spezialisierten sich auch die handwerker weiter so erklärt es sich dass es in köln goldspinnerinnen und seidenmacherinnen gab oder in nürnberg zehn unterschiedliche spezialisierungen im handwerk der schmiede die zünfte als interessenvertretung fast überall bestand zunftzwang für die handwerker handwerksmeister und gelegentlich meisterinnen des gleichen berufszweiges schlossen sich zu vereinigungen zusammen die man zünfte nannte straßennamen wie webergasse oder färbergraben erinnern bis heute daran dass ihre mitglieder in enger nachbarschaft wohnten und arbeiteten die zünfte gaben sich eine zunftordnung in der alle wich tigen bestimmungen aufgeschrieben waren damit alle von ihrem handwerk leben konnten durfte jeder meisterbetrieb nur begrenzte warenmengen herstellen und auch nur zu festgelegten preisen verkaufen auch die qualität der waren wurde genau festgelegt so beeinflussten die zünfte die gesamte handwerkliche wirtschaft heute gültige grundsätze wie angebot und nachfrage bestimmen den preis oder konkurrenz belebt das geschäft galten also nicht ganz im gegenteil die zünfte kümmerten sich aber auch um ihre mitglieder die zunftmeister zahlten in eine gemeinsame zunftkasse ein mit diesem geld konnte im notfall dann bedürftigen geholfen werden zunftmeister wollen in den rat trotz ihrer bedeutung für wirtschaft und gesellschaft waren die zünfte zunächst im stadtrat nicht vertreten das wollten die immer selbstbewusster auftretenden zunftmeister ändern sie versuchten sogar häufig den widerstand der patrizier gewaltsam zu brechen so gelangten sie mancherorts in den stadtrat in anderen städten nur in den weniger bedeutenden erweiterten rat und in einigen blieben sie ganz von politischer einflussnahme ausgeschlossen zunftzwang in vielen städten mussten alle meister eines handwerks der zunft angehören ihre höchstzahl war begrenzt häufig durften auch keine ortsfremden eine werkstatt eröffnen und nur die kinder aus handwerkerfamilien das handwerk erlernen q1 zunftzeichen aus italien, 1602
q3 hutmacher, kürschner und sattler, 1467 üben ihre handwerke aus aus einer handschrift q2 grundsätze einer zunft die straßburger tucherzunft erklärt ihre zunftordnung jahrhundert zum ersten haben wir eine gemeinsame stube haus und hof die uns zur verfügung stehen in dieser stube kommen wir zusammen um miteinander zu essen und zu trinken dort empfangen wir auch unsere gäste wir wählen jährlich einen vertrauenswürdigen mann aus unserer zunft in den großen rat außerdem bestimmen wir einen der in den kleinen rat oder in das gericht abgeordnet wird desgleichen bestimmen alle anderen zünfte von denen es insgesamt gibt jeweils einen vertrauenswürdigen mann für den großen rat fünf meister leiten die zunft weitere fünf übernehmen folgende aufgaben diese fünf sind dann für ein jahr unsere prüfer und besiegler der tuche die die tucher und die weber machen diese fünf müssen schwören alle tuche zu prüfen die guten besiegeln die keine fehler aufweisen außer dem diejenigen mit einem besonderen siegel kennzeichnen die kleine fehler haben und den ganz fehlerhaften tuchen ein siegel verwehren weiterhin lassen wir auch jede nacht ein zunftmitglied mit seinem einfachen harnisch und gewehr zusammen mit anderen aus den anderen zünften auf wache gehen jede zunft stellt jeweils einen oder wenn es nötig ist mehrere wächter weiterhin ist uns zusammen mit zwei anderen zünften eine stelle an der stadtmauer übergeben worden um zu schließen und zu öffnen wenn jemand das handwerk ausüben will so muß er die zunftmitgliedschaft mit dem dafür erforderlichen betrag erwerben dieses geld wird zum nutzen der gesamten zunft verwandt wenn einem von uns freud oder leid widerfährt so bewirten beschreibe die zeichen und ordne sie berufen zu q1 analysiere weshalb diese zeichen angebracht wurden q1 erkläre die bedeutung des begriffs zunft vt arbeite die bestimmungen heraus die für das zusammenleben in der zunft bedeutsam waren q2 erläutere die bedeutung des sprichwortes handwerk hat goldenen boden gehe auch darauf ein wie die zünfte dafür sorgten dass das so blieb vt q2 stell dir vor die straßburger zünfte sollten aufgelöst werden verfasse eine rede in der du schilderst welche folgen das für das städtische leben hätte vt q2 nachgefragt afb afb ii afb ii wir ihn auf unserer stube begeht jemand den todesfall eines der seinigen so gehen wir mit ihm zum gottesdienst weiterhin sind wir verpflichtet wenn ein aufruhr in der stadt ausbricht unter unserem banner mit unserem ganzen harnisch samt unseren zunftvorstehern auf einen platz zu den anderen zünften zu ziehen um dort auf unsere herren bürgermeister und unsere ratsherren zu warten außerdem sind aus allen zünften etliche leute dazu bestimmt bei einem feuer herbeizueilen um zu löschen und das zu tun was dann notwendig ist zunftordnung der tucherzunft straßburg zit nach peter ketsch/gerhard schneider handwerk in der mittelalterlichen stadt stuttgart 1985
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 2
Anders als heute kannten Städte im Mittelalter keine Hausnummern und oft auch keine Straßennamen. Wie konnte man sich da zurechtfinden?
Drucken
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 4
Teile dir die Quelle in Sinnabschnitte ein. Formuliere dann Abschnitt für Abschnitt mit eigenen Worten.
Drucken
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt kein handelsmann gedeiht zu hause mobil sein und das weltweit das ist heutzutage nichts außergewöhnliches mehr im mittelalter hingegen waren reisen mühsam und aufwändig kaufleute allerdings mussten damals viel unterwegs sein da sie nur so ihre geschäfte zum laufen bringen konnten doch wie konnte das erfolgreich gelingen was ein kaufmann können musste jeder stadtbewohner konnte es sehen die tätigkeit der kaufleute lohnte sich die dachgeschosse der kaufmannshäuser dienten als warenspeicher fast täglich wurden waren angeliefert oder abgeholt doch fernhandel war auch unbequem man musste lange und zumeist beschwerliche reisen auf sich nehmen waren einkaufen und transportieren und schließlich anderswo abnehmer finden die einen guten preis bezahlten wichtig war zu wissen wo man sich geld beschaffen konnte und wie man das verdiente geld wieder gut anlegte dazu musste man natürlich lesen schreiben und rechnen können und verbindungen zu anderen kaufleuten unterhalten d1 wichtige hansestädte und handelswege der hansekaufleute um 1400 hamburg hamburg hamburg hamburg hamburg hamburg hamburg hamburg pleskau moskau moskau moskau tula kiew sinope ofen london lübeck hamburg bremen lüneburg danzig visby malmö magdeburg köln stockholm bergen frankfurt a.m antwerpen hull aberdeen edinburgh dublin bristol manchester amsterdam paris bordeaux lyon mailand venedig genua florenz rom pisa ragusa brügge basel nantes la rochelle medina del campo barcelona tours narbonne marseille prag frankfurt leipzig wien stettin pernau bilbao augsburg regensburg nürnberg plymouth santiago de compostella newcastle boston breslau riga pleskau nowgorod narwa dorpat twer moskau tula smolensk polozk königsberg warschau brest rouen southampton soest krakau lemberg kiew rostock kalmar salzburg innsbruck dijon genf bologna yarmouth deventer ripen aalborg oslo thorn reval belgrad cetatea alba konstantinopel sinope straßburg ofen dortmund kopenhagen toulouse zaragoza abo stralsund schwarzes je ebro rhône golf von biscaya meer ka po wichtige hansestadt stadt mit hanse-kontor oder hanse-niederlassung sonstiger ort seehandelsweg der hanse anderer seehandelsweg wichtige handelsstraße silber kupfer eisen salz metallwaren waffen tuche leinen seide vieh leder pelze häute wein bier malz hopfen butter käse wolle wachs holz flachs hanf getreide gewürze duftstoffe km klett klett
neue formen im handel die reichsten kaufleute reisten bald nicht mehr selbst sondern ließen den warentransport von gehilfen durchführen an den wichtigsten handelsplätzen richtete man eigene niederlassungen ein die kontore genannt wurden beispiele dafür waren der stalhof in london oder der peterhof in nowgorod dort gab es große lagerhallen mitunter eigene hafenanlagen und ein eigenes gericht der kaufleute auf ihren reisen und über die kontore erfuhren die händler viele neuigkeiten und gewannen einblicke in leben und gesellschaft ihrer handelspartner so wurde auch der kulturelle austausch innerhalb europas gefördert die hanse – ein kaufmannsbund seit dem jahrhundert schlossen sich in vielen teilen europas kaufleute zu vereinigungen zusammen die man gilden nannte eine von ihnen war die hanse ihre mit glieder gaben sich ein eigenes kaufmannsrecht und erwirkten königliche schutzbriefe gemeinsam organisierten sie handelsreisen um sich unterwegs gegen gefahren besser zu schützen am zielort vertraten sie gemeinsam ihre interessen gegenüber händlern und landesherren so schlossen sie zum beispiel langfristige verträge über günstige zölle und besondere vorrechte beim warentransport ab zur hanse gehörten nicht nur küstenorte sondern auch städte wie lüneburg hildesheim oder köln am erfolgreichsten wurde dieser kaufmannsbund jedoch im ostseeraum die hanse – ein städtebund zu ihren machtvollsten zeiten gehörten etwa größere und über kleinere städte der hanse als städtebund an 1358 ist dieser als dudesche hense deutsche hanse bezeugt er bestand jedoch bereits vorher gemeinsam vertraten die mitgliedsstädte ihre interessen gegenüber landesherren und ausländischen königen dabei ging es hauptsächlich um die freiheit des handels und die sicherheit der fern handelskaufleute dazu schlossen sie bündnisse und führten sogar kriege auf regelmä ßigen hansetagen in lübeck wurden absprachen getroffen und auch städte verurteilt die verträge nicht einhielten die vertretung gemeinsamer interessen bezog sich vor allem auf die freiheit des handels und die sicherheit der fernhandelskaufleute das ende der hanse die blütezeit der hanse endete im jahrhundert kaufleute anderer länder drangen in den ostseeraum vor mit der entdeckung amerikas verlagerten sich die handelsinteressen zunehmend in den atlantischen ozean auch wurden die landesherren mächtiger und drängten den einfluss der städte zurück auf dem letzten hansetag in lübeck im jahr 1669 waren nur noch neun städte vertreten was zugleich den niedergang des städtebundes verdeutlicht aufgelöst worden ist er allerdings nie q1 hafenszene in hamburg, 1497 die darstellung mit dem titel van schiprechte ist teil einer bilderhandschrift zum hamburgischen stadtrecht
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt d2 kaufmannshaus rekonstruktionszeichnung diele schreibkammer winde speicherböden vorratskeller kamin wohnzimmer schlaf zimmer dachkammer wohnkeller kloake q2 beschwerden gegen die hanse die umfangreiche liste wurde von könig håkon von norwegen 1370 vorgelegt vorher hatten sich die hanse städte ihrerseits beim könig beschwert zum ersten wenn einer von ihnen ein delikt begeht gegen einen anderen suchen die kaufleute wo sie können eine geheime streitbeilegung zwischen dem angeklagten und kläger damit die rechtsfrage nicht vor die krone und ihre beamten gezogen werde und was schlimmer ist wenn irgendwelche leute des mordes oder anderer schwerer delikte überführt sind werden die übeltäter auf ihren schiffen fortgebracht mit der absicht weder dem kläger noch der krone genugtuung zuteil werden zu lassen auch haben die seestädte andere städte sich angeschlossen und in die hanse aufgenommen die vorher nicht in ihr waren ohne unsere oder unserer vorgänger zustimmung um nutznießer von privilegien zu sein die nur für die städte gelten die damals in den urkunden unserer vorfahren genannt wurden ebenso haben sie sodann unter sich beschlossen dass die güter und waren unserer untertanen oder untergebenen nicht in schiffe verfrachtet werden in denen sie selbst ihre güter haben zu dem zwecke dass die unseren keinen handelsgewinn haben sollen ferner wo immer sie in unseren häfen angelegt haben verkaufen und kaufen sie was sie wollen entgegen dem recht des königreiches ferner haben die kaufleute in bergen unsere münze abgelehnt welche wir mit zustimmung des ganzen reiches eingeführt haben sie erkennen nur auswärtiges geld wie das von lübeck und stralsund für vollwertig an es ist offensichtlich dass wir dadurch viel unrecht und schaden erlitten haben beschwerdeliste gegen die hansestädte von 1370 zit nach philippe dollinger die hanse stuttgart erw aufl 1998
führe als kaufmannsfrau oder als kaufmann besucher durch dein haus d2 formuliere dazu in einem ersten schritt mögliche fragen der besucher schreibe dann deine ausführungen auf als kaufmann möchtest du dass dein sohn später das geschäft übernimmt erläutere ihm was auf ihn zukommt und wie er sich darauf vor bereiten kann vt stell dir vor du bist ein hansekaufmann du unterhältst dich im hafen von bremen mit einem händler der keiner kaufmannsgilde angehört erkläre ihm worin der vorteil besteht dass du hansekaufmann bist vt du kommst um 1500 das erste mal an den hamburger hafen q1 formuliere deine eindrücke indem du aus einer der drei folgenden aufgaben wählst schreibe einen brief nach hause beginne so heute morgen war ich im hafen ihr glaubt nicht was ich da alles gesehen habe gestalte in dialogform ein gespräch über das hafengeschehen zwischen den beiden personen im roten und grünen gewand am unteren bildrand stelle auf einem werbeplakat den hamburger hafen vor jahren dar arbeite dabei mit sprachlichen und mit grafischen elementen analysiere die beschwerden gegen die hanse antworte als norwegischer händler und als hansekaufmann darauf q2 stelle am beispiel von q3 dar wie sich kaufleute vor betrug schützten du sollst fässer salz von köln nach moskau liefern ein fuhrwerk schafft am tag ungefähr km eine hansekogge etwa km entscheide wie das salz am günstigsten zu den abnehmern gelangt überlege auch welche russischen waren du im raum köln verkaufen könntest d1 erörtere positive und negative seiten eines kaufmannsdaseins im mittelalter nachgefragt afb ii afb ii q3 qualitätssicherung in der hanse aus einem beschluss der lübecker hanseversammlung im juni 1375 ferner kam die klage an die städte wegen der teerund aschetonnen man fälsche die mache den boden und den deckel allzu dick und man fülle erde hinein in dieser sache soll man an preußen stettin kolberg und goland briefe senden damit jeder sich in acht nehme denn wenn man nach dem nächsten st martinstag solche ware findet so soll als fälschung darüber gerichtet werden diesen beschluß soll jede stadt ihren nachbarn mitteilen ferner soll der vogt auf schonen den seinen verkünden daß sie ihren hering so in die tonnen einsalzen daß er an beiden böden und in der mitte gleich gut sei und daß man keine … minderwertigen heringe zwischen die guten packe zit nach johannes bühler bauern bürger und hansa leipzig 1929 d3 rekonstruktionsmodell einer kogge zwischen dem und jahrhundert zählte dieses einmastige segelschiff zum wichtigsten transportmittel der hanse die kogge war ca bis meter lang und fünf bis acht meter breit
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 1
Überlege dir zunächst, welchen Weg durch das Gebäude du nehmen willst: Möchtest du dem Besucher alles zeigen oder nur das Erdgeschoss? Wichtig ist natürlich auch, worin deine Absicht besteht: Geht es um Informationen oder möchtest du den Besucher beeindrucken?
Drucken
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 2
Stelle mithilfe des Verfassertextes zunächst eine Liste zusammen, aus der hervorgeht, was ein Kaufmann können muss. Überlege nun, was davon für einen jungen Menschen wichtig ist und welche Möglichkeiten es gibt, sich auf solche Herausforderungen vorzubereiten.
Du kannst das Gespräch so beginnen: „Mein Sohn, wie du siehst, ist das Geschäft eines Kaufmanns jeden Tag eine neue Herausforderung. Wenn du später einmal meine Arbeit weiterführen wirst, musst du … Deshalb ist es heute schon wichtig, dass …“
Drucken
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 4
Schaue dir zunächst die Bildquelle in allen Details an. Fertige dir eine Tabelle an, in die du notierst, was auf dem Bild zu erkennen ist:
Mithilfe deiner Tabelle kannst du nun den Brief fortführen und von deinen Eindrücken erzählen.
Drucken
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt bauwerke analysieren wer etwas davon versteht sieht bauwerken sofort an wann in etwa sie erbaut worden sind denn bauwerke sind typisch für die zeit in der sie entstanden sind mithilfe von informationen zu baugeschichte baustil und entstehungszeit können sie uns so auskunft über das leben der menschen in früheren zeiten geben oft gibt es bereits gut aufbereitete materialien in museen tourismuszentren oder im internet auf die bei der untersuchung zurückgegriffen werden kann am beispiel des historischen rathauses in münster kannst du lernen solche bauwerke zum sprechen zu bringen musterlösung beschreiben das rathaus wurde wohl um 1200 mit ursprünglich zwei stockwerken errichtet und ersetzte ein älteres fachwerkhaus die sehr aufwendig gestaltete gotische fassa de wurde um das jahr 1400 vor das gebäude gesetzt als ein weitgehend selbstständiger stadtrat darin tätig war das rathaus ist in der stadtmitte münsters am prinzipalmarkt errichtet worden hier in sichtweite des doms tagte das vom stadtherrn dem bischof beauftragte kollegium zu verwaltungsfragen und rechtsprechung das gebäude ist an der vorderseite fast und an der rückseite breit hat also einen trapezförmigen grundriss die länge beträgt fast der schaugiebel die fassade ist hoch analysieren die gotische schaufassade gliedert sich von unten nach oben in das arkadengeschoss als arkaden bezeichnet man pfeiler das darüber befindliche hauptgeschoss mit den vier großen maßwerkfenstern des festsaals und das giebelgeschoss alle waren und sind noch mit verzierungen versehen die meist religiösen ursprungs sind die schaufassade gilt als ein herausragendes beispiel gotischer baukunst im erdgeschoss des gebäudes befinden sich eine bürger halle und dahinter die ältere ratskammer weil hier 1648 ein friedensschluss zum ende des dreißigjährigen krieges ausgehandelt und unterzeichnet wurde heißt er bis heute friedenssaal im obergeschoss befand sich die rüstkammer also ein waffenlager und davor ein festsaal für feierlichkeiten die später darüber ergänzten dachböden wurden an kaufleute als lagerflächen vermietet im untergeschoss befand sich ein weinkeller q1 das historische rathaus in münster im baustil der gotik in deutschland ca 1250–ca 1500 spitzbögen bei fenstern und im gewölbe fenstergestaltung mit maßwerk mit bunten glasfenstern aufgelöste wände strebepfeiler bei kirchen schlanke aufstrebende türme
kompetenztraining fachmethode nachgefragt erkläre mithilfe von q2 bautechniken des mittelalters erkundige dich wie man bestimmte probleme heute löst in vielen städten gibt es noch mittelalterliche bauten vor allem kirchen startet in gruppen ein erkundungsprojekt und geht nach den methodischen arbeitsschritten vor mit euren ergebnissen könnt ihr eine kleine aus stellung in der schule gestalten das gebäude dürfte ursprünglich im auftrag des bischöflichen stadtherrn errichtet worden sein später wurde es von der bürgerschaft umund ausgebaut die baukosten sind entsprechend vom auftraggeber also dem bischof bzw später den bürgern getragen worden von der baugeschichte liegt noch immer vieles im dunkeln erwiesen ist dass das gebäude seit 1200 mehrfach erweitert anund umgebaut worden ist deuten das rathaus zeigte jedem besucher der stadt bischof und bürgerschaft sind auf der höhe der zeit das prachtvolle gebäude stellte den wohlstand und die baukunst der stadt unter beweis wie viele historische gebäude in europa ist auch das rathaus in münster im zweiten weltkrieg schwer beschädigt und in den 1950erjahren rekonstruiert worden schon längst wird im historischen rathaus nicht mehr regiert als eines der wahrzeichen von münster besuchen es aber jährlich viele tausend touristen arbeitsschritte beschreiben analysieren deuten stelle fest um was für ein gebäude es sich handelt und wann es errichtet wurde beschreibe die lage des bauwerkes in der stadt und suche eine erklärung dafür bestimme die maße des gebäudes also länge breite und höhe benenne einzelne teile des bauwerkes und stelle fest in welchem baustil es erbaut wurde bestimme anhand der einzelnen bestandteile und räume die funktion des bauwerkes informiere dich wer das bauwerk errichten ließ und aus welchem anlass erkundige dich wer die bauarbeiten bezahlt hat analysiere die baugeschichte wurden teile nachträglich anoder umgebaut welche gründe gab es dafür stelle vermutungen an wie das bauwerk auf die menschen wirkte und welche absichten der erbauer damit verfolgte triff aussagen über den heutigen verwendungszweck hat er sich geändert dann erkläre warum afb ii q2 spätmittelalterlicher baubetrieb, um 1390 dargestellt ist das biblische motiv des turmbaus zu babel in einer handgeschriebenen prachtbibel
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt jüdisches leben im mittelalter in vielen großen und kleinen städten findet man hinweise darauf dass im mittelalter dort jüdische bewohner zu hause waren sie unterschieden sich von der christlichen bevölkerung in ihren berufen ihrem brauchtum und ihrer kultur doch warum war das so und was brachte das mit sich juden in der stadt in vielen mittelalterlichen städten europas lebten juden eigene bäckereien und metzgereien sorgten dafür dass religiös begründete regeln bei der herstellung von speisen eingehalten werden konnten auch deshalb wohnten juden meist nah beieinander in judengassen oder judenvierteln bei der synagoge als gemeindemittelpunkt ihren lebensunterhalt zu verdienen war für sie keineswegs einfach weil sie keiner zunft beitreten und deshalb als handwerker nur für die jüdische gemeinde arbeiten durften waren viele arm einige wohlhabende juden waren als fernhändler tätig und nutzten dafür be stehende kontakte zwischen den jüdischen gemeinden andere wichen auf das geldverleihen aus es gab auch einige christliche geldverleiher die allerdings die zinsen verheimlichten denn die kirche verurteilte den zinsgewinn als unmoralisch da das risiko groß war nicht immer erhielten sie ihr geld zurück verlangten sie hohe zinsen was jüdischen wie christlichen geldverleihern den ruf des wucherers eintrug willkommene mitbürger das zusammenleben mit der christlichen bevölkerungsmehrheit gestaltete sich regional unterschiedlich wenn herrscher juden ein schutzprivileg ausstellten ihnen also besonderen schutz versprachen erhofften sie sich davon einen vorteil so lud beispielsweise der bischof von speyer 1084 juden in die stadt ein er versprach volle freiheit und einen eigenen und zu ihrer sicher heit auch mit einer mauer umgebenen wohnbezirk samt begräbnisplatz auch am militärischen schutz speyers beteiligte er sie dafür erwartete der bischof dass die jüdischen fernhändler und kaufleute zölle und steuern zahlten und dadurch die einnahmen speyers erhöhten auf diese weise trugen jüdische gemeinden wesentlich zum aufund ausbau von städten bei sündenböcke trotzdem wurden juden auch opfer gewalttätiger übergriffe schon früh misstrauten ihnen viele christen aufgrund ihrer andersartigen tracht und der fremd wirkenden religiösen bräuche synagoge die synagoge bildet den mittelpunkt des jüdischen gemeindelebens hier finden die gottesdienste statt und die synagoge ist zugleich gemeindezentrum und ausbildungsstätte für das studium der religiösen schriften gemeinsam lernen juden im mittelalter: willkommen – geduldet – verfolgt organisiert zu dieser frage in eurer klasse ein gruppenpuzzle arbeit in stammgruppen lest euch die themen der expertengruppen durch und verschafft euch einen überblick über die zu erschließenden materialien überlegt wer aus eurer arbeitsgruppe in welche expertengruppe geht arbeit in expertengruppen erschließt in den expertengruppen die jeweilige lebenssituation von juden im mittelalter mithilfe der angegebenen materialien wie sah jüdisches leben in der mittelalterlichen stadt aus vt juden in der stadt q1 q4 juden im mittelalter willkommen und geduldet vt willkommene mitbürger q1 q3 q4 juden im mittelalter verfolgt vt sündenböcke und ausgrenzung und vertreibung sowie q2 q5 q6 tipp informiert euch ob in eurer heimatstadt im mittelalter eine jüdische gemeinde bestand und schließt ggf informationen dazu in eure arbeit ein arbeit in stammgruppen stellt euch gegenseitig die in den expertengruppen erarbeiteten informationen vor und überlegt welche form der präsentation ihr wählen möchtet plakat tagebucheintrag historisches rollenspiel strukturskizze gruppenpuzzle
vor allem aber warfen die christen den juden vor schuld am kreuzes tod christi zu sein misstrauen steigerte sich in grenzenlosen hass so wurden im jahr 1096 tausende juden während des ersten kreuz zugs im rheinland ermordet gegen große mengen aufgebrachter christen konnten auch landesherren oder stadt räte juden nicht schützen viele juden begingen selbstmord weil sie sich nicht taufen lassen wollten auch später dienten in unerklärlichen notzeiten juden vielen christen als sündenbock und es kam zu brutalen übergriffen so wurde ihnen nach der pestwelle 1348 unterstellt sie hätten die brunnen vergiftet obwohl auch juden an der seuche gestorben waren brutale übergriffe in zahlreichen städten mitteleuropas waren die folge ausgrenzung und vertreibung trotz solcher übergriffe und konflikte lebten juden und christen im mittelalter eng und ohne abgrenzung voneinander zusammen erst am ende des mittelalters und verstärkt mit beginn der frühen neuzeit mussten jüdische familien zunehmend die eigenen viertel verlassen viele stadträte wiesen ihnen ein räumlich beschränktes wohn viertel getto zu dieses wurde abends und an christlichen feiertagen verschlossen viele der vertriebenen juden flohen nach osteuropa und fanden in polen aufnahme weil die örtlichen herrscher sich vorteile für den handel erhofften das jiddisch eine mischung aus deutschen und hebräischen worten behielten sie weiter hin als alltagssprache bei q2 legende vom christenmord die verunglimpfung der juden durch christen fand einen ausdruck in der legende vom angeblichen ritual mord christen verbreiteten das gerücht dass juden während geheimer treffen christliche jungen in einem religiösen ritual töten würden nachträglich kolorierter holzschnitt aus der schedelschen weltchronik von 1493 q1 jüdischer arzt behandelt bischof juden wurden als ärzte oder gelehrte geschätzt holzschnitt 1487
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt beschreibe das leben der juden in mittelalterlichen städten erfasse auch die entwicklung über die jahrhunderte hinweg vt versetze dich in die rolle des bischofs von speyer und halte eine rede in der du erklärst weshalb du juden in die stadt eingeladen hast vt q4 nenne ursachen für judenfeindlichkeit unter den christen vt q2 vergleiche was die bilder q3 und q5 jeweils über das schicksal der europäischen juden im mittelalter aussagen arbeite aus q6 den ablauf der juden verfolgung in straßburg heraus nachgefragt q3 kaiser heinrich vii bestätigt 1312 die privilegien der juden heinrich und ein jüdischer vertreter halten eine schriftrolle mit hebräischen zeichen in den händen buchmalerei um 1340 landeshauptarchiv koblenz q4 privileg für die juden von speyer der bischof von speyer bot juden in mainz an sich in speyer niederzulassen september 1084 als ich rüdiger auch hutzmann genannt bischof von speyer den weiler speyer zu einer stadt gemacht habe habe ich geglaubt die ehre unseres ortes um ein vielfaches zu vergrößern wenn ich hier auch juden ansammelte ich siedelte also die versammelten außerhalb der gemeinschaft und des wohnbezirks der übrigen bürger an und damit sie nicht so leicht durch die unverschämtheit des pöbels beunruhigt würden habe ich sie mit einer mauer umgeben innerhalb ihres wohnbezirks und in der gegend außerhalb des hafens bis zum schiffshafen und im schiffshafen selbst habe ich ihnen das recht zugestanden gold und silber frei zu tauschen und alles zu kaufen und zu verkaufen was sie wünschen dasselbe recht habe ich ihnen auch in der gesamten stadt zugestanden außerdem habe ich ihnen aus dem kirchengut einen begräbnisplatz unter einem erbvertrag gegeben auch dies habe ich hinzugefügt dass ein fremder jude der bei ihnen zu gast ist dort keinen zoll zahlen muss schließlich dass wie der stadtrichter unter den bürgern so auch ihr synagogenvorsteher über alle klagen die sie untereinander erheben oder die gegen sie erhoben werden entscheiden soll geschlachtetes fleisch das sie nach ihrem gesetz für sich als verboten betrachten dürfen sie an christen verkaufen kurz ich habe ihnen als gipfel meines wohl wollens ein gesetz verliehen das besser ist als es das jüdische volk in irgendeiner anderen stadt des deutschen reiches besitzt julius schoeps/hiltrud wallenborn hrsg juden in europa ihre geschichte in quellen band darmstadt 2001
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 4
Um diese Aufgabe zu lösen, musst du dir zunächst die Aussage beider Bilder getrennt erarbeiten. Dabei helfen dir die Hinweise zur Bildinterpretation auf S. 19. Dann kannst du die jeweiligen Aussagen der Bilder einander gegenüberstellen.
Drucken
halte dazu sowohl die einzelnen schritte als auch die handelnden personen und deren interessen fest schreibe als christlicher schmied jakob einen tagebucheintrag über das geschehen in straßburg gehe dabei besonders auf das schicksal des juden david ein bei dem du geld geliehen hast q6 willkommen geduldet verfolgt ordne den verhaltensweisen gegenüber juden beispiele zu vt q1 q6 willkommen geduldet verfolgt stelle dar was wir menschen von heute daraus lernen können und müssen diskutiere dein ergebnis mit lernpartnern afb afb ii afb iii q5 juden fliehen aus einer fränkischen stadt darstellung aus einer pessachhaggada einer textsammlung aus der beim jüdischen pessachfest zur erinnerung an den auszug aus ägypten vorgelesen wird jahrhundert q6 anschuldigungen und verfolgung aus der chronik von straßburg 1349 die stadt hatte geld aufgenommen von den juden hatte rückzahlung zugesichert und ihnen dafür ordnungsmäßig gesiegelte schutzbriefe gegeben und es bestand auch folgende gesetzliche abmachung wer von ihnen geliehen hatte mußte schwerere höhere zinsen zahlen darum wurden sie verhaßt bei männiglich vielen dazu fiel die beschuldigung auf die juden daß sie die brunnen und die fließenden wasser sollten vergiftet haben darob murrte das volk und sie sprachen man sollte sie verbrennen doch gestanden sie die juden nie daß sie der brunnenvergiftung schuldig wären … bürgermeister und rat wollten nichts gegen den schutzbrief tun den die juden hatten von der stadt davon wollte das gemeine volk nichts wissen am freitag fing man die juden am samstag verbrannte man die juden deren waren schätzungsweise wohl gegen zweitausend die sich aber wollten lassen taufen die ließ man leben es wurden auch gegen ihrer mütter und ihrer väter willen viele junge kinder aus dem feuer genommen die getauft wurden was man den juden schuldig war das war alles wett erledigt und wurden alle schuldpfänder und schuldbriefe die diese hatten zurückgegeben das bare geld das sie hatten das nahm der rat und teilte es unter die handwerker zünfte das war auch das gift das die juden tötete zit nach julius höxter quellenlesebuch zur jüdischen geschichte und literatur bd frankfurt 1927 28–30
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 6
Beginne so: „Hier in Straßburg hat es in diesen Tagen eine große Aufregung gegeben. Es sind Brunnen vergiftet worden … Ich hatte mir ja vor einiger Zeit bei dem Juden David Geld geliehen. Er …“
Drucken
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 8
Hier gilt es zu überlegen, welche sinnvollen Vergleiche du anstellen kannst.
– Gibt es aktuell Personengruppen, die in einer ähnlichen Situation sind wie die Juden im christlich geprägten Mittelalter?
– Und wie geht die Öffentlichkeit mit ihnen um?
– Hast du vielleicht sogar Kontakte zu Menschen in diesen Gruppen?
Denke dabei nicht nur an die Situation in Deutschland, sondern auch an andere Länder Europas und der Welt.
Drucken
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt frauen in der stadt du hast bereits erfahren dass griechische und römische frauen in der antike ein ganz anderes leben führten als heute auch im mittelalter waren frauen im vergleich zu heute noch sehr eingeschränkt in ihren möglichkeiten wie nun lebten und arbeiteten sie in der mittelalterlichen stadt die arbeitswelt der frauen als bevorzugte und wichtigste aufgabe hatten frauen im mittelalter den haushalt zu führen und die kinder zu erziehen viele frauen verdienten sich ihren lebensunterhalt als mägde oder wäscherinnen doch es gab auch krämerinnen und weinhändlerinnen einzelnen gelang es sogar kauffrau oder ärztin zu werden daneben war die mitarbeit der frauen im handwerksbetrieb ihrer männer recht verbreitet in köln gab es eigene zünfte der garnmacherinnen goldspinnerinnen und seidenmacherinnen doch handwerkerzünfte in denen frauen unter sich waren bildeten die große ausnahme von den meisten zünften wurden selbstständig arbeitende frauen abgelehnt aus hildesheim jedoch ist folgendes überliefert die witwe eines leine webermeisters wurde schon beim toten essen im zunfthaus bedrängt möglichst bald einen der verwitweten meister zu heiraten sie wehrte sich und konnte schließlich selbstständig bleiben den betrieb aber durfte sie ihrer tochter nicht vererben die rechte der frauen frauen waren in den städten rechtlich frei konnten verträge abschließen und vor gericht selbstständig prozesse führen ihren ehemann durften sie zwar selbst auswählen doch oft genug beeinflussten die wirtschaftlichen interessen der eltern die wahl ämter im stadtrat in der verwaltung oder bei gericht konnten frauen nicht übernehmen denn politische rechte besaßen sie nicht die gemeinschaft der beginen seit etwa 1200 breitete sich das gemeinschaftsleben der beginen als neue selbstbestimmte lebensform für frauen aus oft waren ihre häuser zu abgegrenzten beginenhöfen zusammengefasst wie in den nonnenorden führten sie ein frommes christliches leben mit gemeinsamen gebeten und mahlzeiten hier verdienten sich die bewohnerinnen mit der erziehung und dem unterricht von mädchen der krankenpflege und mit handarbeit ihren lebensunterhalt die frauen waren dadurch versorgt und genossen den schutz in einer selbst verwalteten gemeinschaft den zunftmitgliedern war die selbsttätige arbeit der frauen nicht recht sie sahen in den frauengemeinschaften eine wachsende konkurrenz beginen seit dem jahrhundert angehörige einer christlichen gemeinschaft ohne dauerndes gelübde mit gemeinsamen gebeten und mahlzeiten q1 töpferin darstellung auf einer spielkarte nachträglich kolorierter holzschnitt um 1450
q4 wendel und gottschalk ratsherr hermann von weinsberg 1518–1597 aus köln berichtet über die 1479 geschlossene ehe seines großvaters gottschalk mit wendel pennincks diese wendel war betagt hatte zwei töchter von pancratz bachem ihrem ersten mann noch am leben und sie handelte mit korn weizen gerste und dergleichen machte malz verkaufte das und handelte viel mit den landleuten bauern des umlands wendel mietete ein haus da zog sie mit gottschalk hinein und sie trieben zusammen handel mit korn malz und allerlei früchten und wendel starb zuerst und gottschalk behielt genug von dem ihrigen und stand sich wohl zit nach johann jakob hässlin hrsg das buch weinsberg aus dem leben eines kölner ratsherrn köln aufl 1990 q2 eine händlerin übergibt einer kundin einen männerrock holzschnitt 1490 q3 beginen bereiten ein begräbnis vor flämische buchmalerei mitte jahrhundert vergleiche welche rechte besaßen die frauen in den mittelalterlichen städten in welchen bereichen waren ihre rechte eingeschränkt beschreibe die tätigkeiten der frauen auf den bildern q1 und q2 und überlege welche soziale stellung sie einnahmen arbeite heraus welche beweggründe es für die eheschließung von gottschalk und wendel gab q4 gestalte ein plakat auf dem die beginen die regeln für ihr konventsleben vor augen geführt bekommen q5 erkläre weshalb die einzelnen vorschriften in die statuten aufgenommen worden sind q5 und überlege wie du diesbezüglich das plakat ergänzen könntest als mutter oder vater gibst du deiner tochter einen rat wie sie später leben sollte schreibe einen brief dazu und denke daran zu welcher berufsgruppe du selbst gehörst vt q1 q5 nachgefragt afb afb ii q5 wie beginen leben sollen aus den statuten des beginenkonvents um 1309 es sollten nur brave und ehrsame personen mit genehmigung ihrer eltern aufgenommen werden keine natürlichen schwestern außer zweien keine persönlich unfreie jede aufgenommene schwester soll zum lebensunterhalt etwas besitzen oder eine kunst verstehen um sich die existenzmittel den lebensunterhalt zu erwerben keine schwester des hauses soll ohne erlaubnis der vorsteherin ausgehen und nie allein sondern stets zu zweien diejenige schwester die sich unmanierlich und ungeistlich beträgt soll aus dem haus entfernt werden statuten des beginenkonvents zit nach herbert krimm hrsg quellen zur geschichte der diakonie altertum und mittel alter bd stuttgart 1960 nr
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 1
Trage die Informationen des Verfassertextabschnitts „Rechte der Frauen“ zunächst in diese Tabelle ein:
Danach kannst du die Informationen in einen Text umwandeln:
„Einerseits besaßen die Frauen das Recht … Andererseits konnten sie aber nicht …“
Drucken
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 3
Überlege zunächst, welche Beweggründe es für eine Eheschließung gibt. Analysiere die Quelle dann auf Hinweise, die deine Überlegungen stützen oder widerlegen. Notiere die entsprechenden Wörter und Wortgruppen als Beleg.
Drucken
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 5
Fasse zunächst die jeweilige Vorschrift knapp zusammen und trage sie in die linke Spalte ein. Stelle dann gegenüber, welche Absicht wohl damit verfolgt wurde.
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt die mongolen erschaffen ein weltreich die mongolen eroberten im jahrhundert ein reich das vielfach größer war als die antiken großreiche rom und china wie konnte ein ursprünglich kleines nomadenvolk eine solche leistung vollbringen welche auswirkungen hatte ihre herrschaft auf europa die mongolen … der aufstieg der mongolen zu einer weltmacht begann mit dschingis khan bis zu seinem tod schuf der mongolenherrscher ein reich das sich vom pazifischen ozean bis ans kaspische meer erstreckte unter seinem enkel kublai khan erreichte das herrschaftsgebiet um das jahr 1280 seine größte ausdehnung die mongolen beherrschten damit weite teile der damals bekannten welt … führen brutale kriege nach außen … es gibt viele gründe für die militärischen erfolge der mongolen so waren sie gefürchtete reiterkrieger gut trainiert gehorchten sie ihren anführern auch in den schwierigsten situationen als hauptwaffe verwendeten sie einen besonders durchschlagkräftigen bogen den sie meisterhaft beherrschten selbst bei vollem galopp und gegen die laufrichtung des pferdes trafen sie sicher ihr ziel als nomaden waren sie es gewohnt auch mit wenig nahrung auszukommen und lange wegstrecken zurückzulegen wenn sie eine stadt eroberten töteten sie häufig große teile der bevölkerung auch trieben sie immer wieder bewohner eines ortes als lebenden schutzschild vor sich her um den nächsten ort zu erobern solche grausamkeiten hatten system die armeen der mongolen waren der bevölkerung in den eroberten gebieten zahlenmäßig unterlegen die angst vor dem mongolensturm eilte den kriegern jedoch voraus und verhinderte aufstände in den besetzten gebieten gleichzeitig verschonten die mongolen handwerker händler ingenieure oder schriftkundige um von ihrem wissen zu profitieren so konnten sie große städte nur mithilfe chinesischer belagerungsgeräte und techniken einnehmen … und schaffen frieden im inneren innerhalb ihres riesigen imperiums herrschten dagegen außergewöhnlich geordnete und friedliche zustände die man mit dem begriff pax mongolica der mongolische friede beschreibt schon dschingis khan schuf ämter zur verwaltung des reiches und ließ für die mongolische sprache eine schrift entwickeln die leicht verändert noch bis heute verwendet wird diese diente dazu gesetze festzuhalten dschingis khans nachfolger baute ein enges netz von poststationen aus nachrichten konnten nunmehr auch über weite strecken verschickt werden zum frieden innerhalb des reiches trug auch bei dass die mongolen eine weitestgehend freie religionsausübung erlaubten am hof des khans in der hauptstadt karakorum lebten buddhisten muslime und christen nebeneinander q1 mongolischer reiterkrieger persische miniatur jahrhundert dschingis khan sein ursprünglicher name lautete temüjin er wurde um 1160 geboren zwischen 1184 und 1204 unterwarf er die nomadenvölker die auf dem gebiet der heutigen mongolei lebten und wurde 1206 zum khan herrscher ernannt außerdem erhielt er den ehrennamen dschingis khan harter bzw ungestümer herrscher
fenster zur welt auswirkungen der pax mongolica vor allem mit der kostbaren chinesischen seide zeigten weltliche und geistliche herrscher im mittelalter ihre macht und ihren reichtum die wertvollen waren wurden über tausende kilometer auf landund seewegen gehandelt eine wichtige rolle hierbei spielte die seidenstraße diese bestand aus einem netz von verkehrswegen und handelsrouten europäische händler bereisten die seidenstraße zunächst nicht selbst sondern erhielten die waren von zwischen händlern die waren verteuerten sich dabei auf dem weg zum zielort denn die zwischenhändler wollten gewinn machen die wege führten durch wüsten über hohe bergpässe und durch flüsse räuber lauerten an den wegen und schreckten auch vor mord nicht zurück je nach jahreszeit machten stürme oder dürren ganze abschnitte des weges unpassierbar da die mongolen innerhalb ihres reiches die seidenstraße kontrollierten und schützten konnten nun europäische händler gesandte abenteurer und missionare auf vergleichsweise sicherem weg bis in die entlegensten winkel asiens gelangen einige reisende hielten ihre beobachtungen und erlebnisse schriftlich fest bis heute sind ihre reiseberichte für uns eine der wenigen und damit unverzichtbaren quellen im jahr 1347 gelangte schließlich die pest auf den viel bereisten handelswegen von asien bis nach mitteleuropa innerhalb von nur fünf jahren fiel ihr rund ein drittel der europäischen bevölkerung zum opfer das ende der pax mongolica nach 1260 wurde das mongolische reich infolge von erbstreitigkeiten in vier reiche khanate geteilt streitigkeiten innerhalb der mongolischen führungsschicht und der ausbruch der pest waren zwei wesentliche gründe für den weiteren zerfall die pax mongolica bestand deshalb nur rund jahre bis etwa 1350 in dieser zeitspanne aber vernetzte die mongolische herrschaft weltteile miteinander die bislang kaum in kontakt standen nie zuvor in der geschichte waren menschen waren wissen und ideen derart ungehindert über solche distanzen hinweg gereist d1 das mongolische reich im 13. jahrhundert mongolensturm als mongolensturm bezeichnet man die überfallartigen eroberungen der mongolen in asien und europa in den jahren 1241/42 erreichten die mongolen das heutige polen und österreich erst der tod ihres khan führte zum rückzug der mongolen in europa pest auch schwarzer tod die pest ist eine seuche die sich im jahrhundert über die seidenstraße bis nach europa verbreitete der erreger stammte aus asien und wurde von ratten auf flöhe und menschen übertragen lissabon karakorum hanoi hanoi hanoi samarkand alexandria alexandria alexandria alexandria arabien indie khanatt derer khanat der khana tschagataitai tschagatai tschaga arabisches baikalseee baikalsee baikalsee baikalse nil indische ze an indische ze an burchan chaldun rom venedig genua lissabon antwerpen paris moskau bolgar kiew breslau karakorum lhasa pagan thang long hanoi delhi samarkand bagdad damaskus konstantinopel sarai neu-sarai alexandria herat kambalyk peking arabien afrika ibet indien ilkhanat khanat khanat der reich des grosskhans tschagatai goldenen horde indische ze an pazifischer arabisches meer ozean baikalsee aralsee schwarzes meer balchaschsee kaspisches meer donau ia hu nil mongolische feldzüge reich des großkhans ab 1271 khanat tschagatai khanat der goldenen horde ilkhanat seidenstraße landweg seidenstraße seeweg sonstiger wichtiger landweg sonstiger wichtiger seeweg ausgangsgebiet dschingis khans machtbereich dschingis khans bis zu seinem tod 1227 kle kle kle klett 2000 km
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt q2 der „mongolensturm der geistliche rogerius von torre maggiore erlebte 1241 den einfall der mongolen in ungarn er geriet in gefangenschaft und berichtete über diese zeit nach seiner flucht zu beginn seines berichts wendet er sich an die leser ich habe diese untersuchung nicht geführt um jemandem etwas zu entziehen sondern um zu unterweisen damit die lesenden erkennen und die erkennenden glauben die glaubenden aber begreifen daß die tage des ver derbens nahe sind und die zeiten sich dem ende zuneigen. [… über die zerstörung des dorfes pereg berichtet er so kämpften sie die mongolen eine woche lang bei tag und nacht bis sie die gräben gefüllt hatten und das dorf einnahmen die ritter und die adligen damen die in großer zahl vertreten waren brachte man aus dem dorf auf ein freies feld die bauern auf ein anderes man beraubte sie ihres geldes der waffen kleider und sonstiger besitztümer und mordete sie grausam mit beilen und schwertern nur einige frauen und mädchen ließ man am leben um sie zu mißbrauchen nur jene überlebten von den anderen die sich vom blut anderer opfer bespritzt hatten hinfallen lassen und sich so verbergen können o welch schmerz grausamkeit und unermeßliches wüten wer hätte als vernunftbegabter mensch die abschlachtung einer volksmenge mitansehen können ohne diesen ort zu recht als blutacker zu bezeichnen zur belagerung der burg großwardein als sie die tartaren aber viele tage nicht mehr erschienen und man glaubte daß sie sich ganz zurückgezogen hätten verließen krieger und andere leute in großer zahl die burg in vertrauen auf deren abzug und begannen allgemein die häuser außerhalb der burg zu beziehen und so griffen die tartaren deren aufenthaltsort man nicht kannte sie im morgengrauen an töteten einen großen teil derer die nicht mehr zur burg fliehen konnten und umzingelten die burg rogerius von torre maggiore klagelied in hansgerd göckenjan hrsg der mongolensturm berichte von augenzeugen und zeitgenossen graz u.a 1985 127–187 hier übers erläutert von hansgerd göckenjan q3 paiza – mit schutz durchs reich paiza aus dem jahrhundert mit paiza ausgestattet konnten reisende unter anderem die mongolischen poststationen zum pferdewechsel benutzen die aufschrift lautet durch die kraft des ewigen himmels der name des khans sei geheiligt q4 pax mongolica gleich einfache reise der franziskanermönch wilhelm von rubruk reiste im auftrag könig ludwigs ix ins mongolische reich 1253 bis 1255 nach seiner reise verfasste er einen reisebericht für den könig endlich kam ein reicher mongole zu uns er sagte ich soll euch zu mangukhan großkhan von 1251–1259 führen dies ist eine reise von vier monaten und dort ist es so kalt daß die steine und bäume vor kälte zerspringen überlegt euch ob ihr das durchstehen könnt. [… wenn ihr das nicht durchsteht so lasse ich euch liegen unbeschreiblich waren die qualen an hunger und durst kälte und anstrengung die wir durchzustehen hatten denn nahrungsmittel gaben sie uns nur abends am morgen bekamen wir etwas zum trinken oder hirsebrei am abend erhielten wir fleisch das vorderteil eines hammels mit rippen und etwas fleischbrühe manchmal mußten wir weil es an brennmaterial mangelte das fleisch halb gekocht oder ganz roh verzehren am anfang verachtete uns unser führer gar sehr und es war ihm zuwider uns führen zu müssen [… wilhelm von rubruk reisen zum großkhan der mongolen von konstantinopel nach karakorum 1253–1255 stuttgart 1984 neu bearb hrsg von hans leicht
fenster zur welt wie konnte das eigentlich kleine volk der mongolen ein riesiges imperium aufbauen und erhalten stellt gemeinsam hypothesen auf d1 und überprüft sie vt q1 q3 beschreibe das aussehen und die ausstattung des reiters q1 versetze dich in einen christlichen mönch dem die flucht aus dem mongolischen reich gelang vt q1 q2 nach seiner rückkehr hält er seine beobachtungen zu den kriegszügen fest schreibe diesen bericht charakterisiere den handel auf der seidenstraße vt q4 stellt euch vor ein europäischer kaufmann möchte einen befreundeten händler überzeugen mit ihm ins mongolische reich zu reisen der freund sieht dieses vorhaben kritisch vt q3 q4 gestaltet rollenkarten und führt das gespräch vor der klasse auf erläutere wie die unterschiedlichen religionen am hof des großkhans aufeinandertreffen q5 erkläre welches verhältnis zwischen dem osten und westen sich an der quelle q6 ablesen lässt erläutere weshalb man das mongolische reich als imperium bezeichnet erörtert inwiefern europa von den verbindungen zum mongolischen reich profitierte nachgefragt afb afb ii afb iii q5 religionsfragen am hof des großkhans trifft wilhelm von rubruk auf vertreter verschiedener religionen in einem religionsgespräch diskutiert er mit muslimen sarazenen und buddhisten götzendienern ihre eigene religion stellten die mongolen nicht zur diskussion mit ihr begründeten sie ihre herrschaft so waren wir also am vorabend von pfingsten in unserem gebetshaus versammelt mangukhan schickte drei sekretäre die als schiedsrichter tätig sein sollten nämlich einen christen einen sarazenen und einen götzendiener uns wurde laut verkündet dies ist der befehl mangus er befiehlt daß sich bei todesstrafe niemand unterstehen solle gegen eine andere partei streitsüchtige oder kränkende worte zu gebrauchen noch einen tumult vom zaune zu brechen der diese verhandlung stören würde ich sagte also zu jenem götzendiener wir glauben festen herzens und bekennen es auch mit dem munde daß gott ist und daß es nur einen gott gibt und zwar nur einen in vollkommener einheit woran glaubt ihr er antwortete nur die toren sagen daß es nur einen gott gibt die weisen hingegen sprechen von mehreren göttern gibt es nicht in deinem land große herrscher und ist hier nicht mangukhan der größte herrscher so verhält es sich auch mit den göttern[ darauf warf ich ein du bringst da ein schlechtes beispiel oder gleichnis von den menschen in ihrem verhältnis zu gott auf diese weise könnte jeder mächtige in seinem land ein gott genannt werden so erwiderte er endlich kein gott ist allmächtig da brachen die sarazenen in schallendes gelächter aus wilhelm von rubruk reisen zum großkhan der mongolen von konstantinopel nach karakorum 1253–1255 stuttgart 1984 188–191 neu bearb hrsg von hans leicht q6 chinesische“ drachen aus europa italienische seide mit drachenmotiv jahrhundert germanisches nationalmuseum chinesische seide war in europa so beliebt dass sogar asiatische motive wie drachen oder lotusblumen kopiert wurden
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 1
– Überlegt zunächst, auf welche Hindernisse die Mongolen stießen, als sie in andere Gebiete vordrangen.
– Überlegt euch auch, was die Mongolen grundsätzlich benötigten, damit ihr Reich funktionierte. Sprecht auch darüber, welche Schwierigkeiten sich in einem besonders großen Reich ergeben.
Drucken
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 5
– Überlegt zunächst grundsätzlich, wie Kaufleute arbeiten.
– Durchsucht dann arbeitsteilig die Materialien nach Argumenten, die für bzw. gegen die Reise ins mongolische Reich sprechen, und haltet sie auf euren Rollenkarten fest. Achtet dabei darauf, dass ihr die Perspektive eines Kaufmanns beibehaltet.
– Notiert darunter auch mögliche Argumente der anderen Seite und sucht Gegenargumente. Formulierungsvorschlag: „Es kann schon sein, dass … schwierig ist, man muss aber bedenken, dass …“.
Tipp: Lest euch noch einmal die methodischen Schritte zu den Rollenspielen auf S. 221 durch.
Drucken
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt jerusalem und die kreuzzüge jerusalem war und ist für juden christen und muslime eine heilige stadt ein ort friedlicher begegnung war die stadt darum aber nicht immer es gab zeiten wo sie im mittelpunkt gewalttätiger konflikte stand etwa im zeitalter der kreuzzüge warum gilt jerusalem als heilige stadt und wie kam es zu den kreuz zügen dreimal heiliges jerusalem sowohl juden als auch christen und muslime verehren seit jahrhunderten in jerusalem orte die für ihre religion eine ganz besondere bedeutung haben für juden ist das die klagemauer sie ist ein überrest des tempels der chr nach einem aufstand der juden von den römern die damals jerusalem und das land der juden beherrschten zerstört wurde über jahrhunderte war der tempel zentrum der jüdischen gottesverehrung gewesen im römischen reich zählte er zu den prächtigsten heiligtümern täglich wurden hier von priestern opfer dargebracht in ihm wurde das allerheiligste der juden aufbewahrt ein schrein mit den gesetzestafeln die gott angeblich einst den juden gegeben haben soll den christen gilt jerusalem als heilige stadt weil jesus christus hier am kreuz gestorben und aus seinem grab auferstanden sein soll diese sicht setzte sich allerdings erst durch als helena die mutter des römischen kaisers konstantin und eine getaufte christin im jahr den leidensweg jesu den dieser mit seinem kreuz zum hinrichtungsort gegangen sein soll und sein angebliches grab aufsuchte auf bitten seiner mutter ließ konstantin hier die grabes kirche errichten zusammen mit dem leidens weg wurde sie seitdem zum ziel christlicher pilger muslime verehren in jerusalem den felsendom auf dem tempelberg oberhalb der klagemauer er wurde um an dem ort errichtet von dem aus der prophet mohammed eine reise in den himmel unternommen haben soll dort soll er jüdischen und christlichen propheten und sogar gott begegnet sein d1 jerusalem mit felsendom und klagemauer heutige ansicht pilger von lat pelegrinus fremd fremder besucher heiliger stätten in fremden ländern hörtipp in der kathedrale von clermont sn22pw
fenster zur welt das zeitalter der kreuzzüge beginnt im zuge der ausbreitung des islam kam jerusalem seit unter islamische herrschaft den friedlichen besuch von pilgern aller drei religionen behinderte das nicht anders wurde es als ca 1060 bis 1090 muslimische türkische herrscher aus der familie seldschuk ihre krieger zum heiligen krieg gegen das christliche byzantinische reich aufriefen und das bis dahin byzantinische kleinasien eroberten in seiner not bat der byzantinische kaiser den römischen papst um hilfe dem passte das denn damit konnte er seinen vorrang vor dem abendländischen kaiser beweisen sogar wenn es um krieg ging 1095 rief er auf einer versammlung von bischöfen und weltlichen fürsten in der französischen stadt clermont die europäische ritter schaft zu einem kreuzzug auf ziel sollte die verteidigung des christentums durch die befreiung jerusalems und des heiligen landes von den muslimen sein den teilnehmern versprach er reiche beute sünden vergebung und das paradies denen die dabei ihr leben lassen sollten das echo auf die rede war gewaltig tausende ritter gelobten ihre teilnahme am kreuzzug aber noch vor ihnen machte sich überstürzt ein bauernheer verlockt durch die versprechungen des papstes auf den weg teile davon benahmen sich allerdings wie räuber sie brandschatzten die judenviertel einiger städte am rhein angeblich um den tod jesu zu rächen für dessen kreuzigung juden verantwortlich gewesen seien jerusalem erreichten die bäuerlichen kreuzfahrer nicht 1096 wurden sie bei nikäa von türkischen truppen vernichtet die ritter dagegen vertraut mit kampf und krieg bereiteten sich sorgfältig auf den kreuzzug vor aufgeteilt in mehrere heere zogen sie zuerst nach konstantinopel 1097 drangen sie in kleinasien ein zugute kam ihnen dass die muslimischen herrscher untereinander uneins waren und keine gemein same abwehr zuwege brachten dennoch brauchten die ritter zwei jahre um sich nach jerusalem durchzukämpfen am juli 1099 erstürmten sie die stadt wobei sie ein ungeheures blutbad unter den bewohnern anrichteten heiliger krieg krieg zur verteidigung oder zur ausbreitung einer religion kreuzzug der vom papst verkündete heilige krieg der christen zur ver teidigung und aus breitung der christlichen herrschaft er wurde im mittelalter gegen muslime heidnische slawen und christliche ketzer geführt heiliges land christliche bezeichnung für die region palästinas in der jesus gelebt und gewirkt hat d2 erster kreuzzug nach palästina, 1096–1099 córdoba sizilien sizilien zypern zypern rom köln rouen clermont paris bourges lyon toulouse toledo córdoba bouillon trier mainz worms speyer regensburg krakau kiew wien buda mailand verona venedig pisa genua belgrad bari tarent brindisi durazzo thessaloniki sofia athen konstantinopel nikäa caesarea ikonion edessa bagdad antiochia tripolis damaskus akkon jersusalem kairo maarat an-numan sardinien sizilien kreta zypern korsika kgr polen kg ungarn serbien kalifat von bagdad kgr kastillien gft barcelona kgr aragon kgr navarra gft edessa gft tripolis kgr jerusalem normannische reiche russische fürstentümer römischgr kr kl ie reich deutsches ebro atlantischer ozean bauernkreuzzug 1096 ritterkreuzzug 1096–1099 stadt in der juden beraubt und getötet wurden stadt in der muslimische bevölkerung getötet wurde kreuzfahrerstaaten nach dem ersten kreuzzug römische christen griechisch-orthodoxe christen andere christen muslime religiöse bekenntnisse um 1100 km kle klett
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt kreuzfahrer im heiligen land die kreuzfahrer herrschten nach der eroberung jerusalems auch über teile palästinas und syriens allerdings waren sie überall in der minderzahl gegenüber der einheimischen bevölkerung aus syrischen christen und muslimen da nur wenige europäer dauerhaft in palästina blieben änderte sich das kaum manche der europäer passten sich zwar in kleidung und essgewohn heiten der orient alischen kultur an doch die meisten hielten an ihren europäischen sitten und bräuchen fest nicht zuletzt trennten die sprachen arabisch und franzö sisch einheimische und europäer so lebten sie eher nebenals miteinander und für die einheimischen blieben die europäer fremde besatzer zwar nahm der pilger verkehr aus europa zu doch die meisten pilger blieben nur kurz und interessierten sich nicht für land und leute als es tatkräftigen muslimischen herrschern gelang die muslime zum heiligen krieg gegen die europäer zu einigen gerieten diese zunehmend unter druck 1187 mussten sie sich aus jerusalem zurückziehen neue kreuzzüge aus europa blieben erfolglos 1291 endete die herrschaft der kreuzfahrer schließlich mit dem verlust ihrer letzten festung akkon so wie sie begonnen hatte mit einem ungeheuren blutbad nur waren diesmal die muslime sieger die kreuzzüge und ihre folgen durch die kreuzzüge ins heilige land und die dortigen kreuzfahrerstaaten begegneten europäische christen zwar muslimischen und christlichen bewohnern der länder am östlichen mittelmeer innerlich jedoch blieben sie sich fremd sicherlich nahm in gelehrtenkreisen die kenntnis der jeweils anderen religion zu so wurde 1143 erstmals der koran die heilige schrift der muslime in die europäische gelehrtensprache latein übersetzt doch bei den meisten europäern und orientalen hinterließen die kreuzzüge ein tiefes gefühl von misstrauen und feindschaft günstig wirkten sich die kreuzzüge dagegen für die italienischen seestädte venedig genua und pisa aus auf ihre schiffe waren die kreuzfahrer für die verbindung mit europa angewiesen dafür mussten sie den städten gebiete am östlichen mittel meer rand abtreten auf denen diese handels stützpunkte anlegten von hier aus verkauften sie holz und eisenwaren an orientalische kaufleute und erwarben von diesen orientwaren wie gewürze und edelsteine die in europa gewinn brachten das machte beide seiten reich religiöse unterschiede störten diese geschäftsbeziehungen nicht daher überdauerten sie auch die zeit der kreuzzüge palästina jüdischarabisch besiedeltes gebiet am östlichen mittelmeerrand zwischen küste und fluss jordan orient von lat oriri auf gehen aus europäischer sicht die länder der erde in richtung des sonnenaufgangs am morgen daher auch morgenland gegenbegriff okzident abendland koran heilige schrift der muslime enthält die göttlichen offenbarungen des propheten mohammed die im islam verbindliche glaubenswahrheiten sind q1 kreuzzugspropaganda in europa muslime morden plündern schänden kirchen französische miniatur um 1325
fenster zur welt q2 der papst ruft zum kreuzzug auf der mönch robert von reims hört 1095 die rede urbans ii und überliefert sie 1107 so ihr volk der franken gottes geliebtes und auserwähltes volk aus dem land jerusalem und der stadt konstantinopel kam schlimme nachricht ein fremdes volk ein ganz gottfernes volk hat die länder der dortigen christen besetzt durch mord raub und brand entvölkert es hat die kirche gottes gründlich zerstört sie beflecken die altäre mit ihren abscheulichkeiten und stürzen sie um wem anders obliegt die aufgabe dieses land zu befreien als euch euer land in dem ihr wohnt ist dicht bevölkert es liefert seinen bauern kaum die bloße nahrung daher kommt es daß ihr euch gegenseitig bekämpft aufhören soll unter euch der haß nehmt das land dort dem gottlosen volk macht es euch untertan jerusalem ist der mittelpunkt der erde das fruchtbarste aller länder jerusalem erfleht unablässig eure hilfe schlagt also diesen weg ein zur vergebung eurer sünden nie verwelkender ruhm ist euch im himmelreich gewiß zit nach arno borst lebensformen im mittelalter in georges tate die kreuzritter ravensburg 1993 q4 eroberung aus christlicher sicht ein christlicher augenzeuge berichtet um 1110 über die eroberung jerusalems in die stadt eingedrungen verfolgten unsere pilger die muslime bis zum tempel des salomo wo sie während des ganzen tages den unsrigen den wütendsten kampf lieferten so daß der ganze tempel von ihrem blut überrieselt war nachdem die unsrigen die heiden endlich zu boden geschlagen hatten ergriffen sie im tempel eine große zahl männer und frauen und töteten oder ließen leben wie es ihnen gut schien bald durcheilten die kreuzfahrer die ganze stadt und rafften gold silber pferde und maulesel an sich dann glücklich und vor freude weinend gingen die unsrigen hin um das grab unseres erlösers zu verehren regine pernoud hrsg die kreuzzüge in augenzeugenberichten münchen aufl 1980 übers von thürnau q3 eroberung aus muslimischer sicht ein muslimischer geschichtsschreiber berichtet im jahr 1231 über die eroberung jerusalems im jahr 1099 die einwohner wurden ans schwert geliefert und die franken kreuzfahrer blieben eine woche in der stadt während derer sie die einwohner mordeten in der alaqsamoschee töteten die franken mehr als siebzigtausend muslime unter ihnen viele imame religionsgelehrte fromme und asketen aus dem felsendom raubten die franken unermeßliche beute die flüchtlinge erreichten bagdad im ramadan in der kanzlei des kalifen gaben sie einen bericht der die augen mit tränen füllte bei der erzählung was die muslime in der erhabenen heiligen stadt erlitten hatten francesco gabrieli hrsg die kreuzzüge aus arabischer sicht münchen 1976 übers von kaltenbornstachau q5 vom erlaubten krieg gegen die muslime ein englischer geistlicher schreibt dazu 1188 darf man sarazenen muslime etwa ermorden etwa weil gott ihnen palästina gegeben hat und zu besitzen erlaubte er hat gesagt ich will nicht den tod des sünders muslime sind menschen von derselben naturbeschaffenheit wie wir sicher müssen sie von unserem besitz vertrieben und verjagt werden weil alle rechte es erlauben gewalt mit gewalt zu vertreiben aber in maßvoller und untadeliger weise auf jeden fall müssen sie mit der kraft des wortes gottes überzeugt werden so daß sie freiwillig und ohne zwang zum rechten glauben kommen denn gott haßt zwang wer immer also den glauben mit gewalt zu verbreiten sucht verläßt die lehre des glaubens der papst der stellvertreter gottes auf erden ruft geistliche und weltliche personen zum kreuzzug auf und gewährt ihnen vergebung all ihrer sünden ich wage seine urteilsfähigkeit nicht in frage zu stellen aber das eine glaube ich das ver gießen jeglichen blutes geschweige das von menschen bringt keine sündenvergebung radulfus niger de re militari et triplici via peregrinationis hierosolimitane eingl hrsg schmugge berlin/new york 1977 übers von peter offergeld
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt q6 kreuzfahrer zerstören den islamischen felsendom in jerusalem arabische malerei jahrhundert q7 zusammenleben mit den christen ein muslimischer augenzeuge berichtet um 1140 über seine erfahrungen mit den franken bezeichnung der muslime für die kreuzfahrer es gibt unter den franken einige die sich im lande angesiedelt und begonnen haben auf vertrautem fuße mit den muslimen zu leben sie sind besser als die anderen die gerade neu aus ihren heimat ländern gekommen sind aber jene sind die ausnahme hierzu soviel als ich mich in jerusalem aufhielt ging ich gewöhnlich in die moschee alaqsa wenn ich in die moschee alaqsa kam wo sich christliche ritter meine freunde eingerichtet hatten stellten sie mir immer einen betraum für meine gebete zur verfügung eines tages trat ich dort ein um mit dem gebet zu beginnen da stürzte ein franke herbei ergriff mich drehte mich mit dem gesicht nach osten und sagte so betet man sofort griffen die ritter ein entfernten ihn und entschuldigten sich mit den worten bei mir er ist ein fremder der erst in diesen tagen aus dem frankenland gekommen ist und noch nie jemanden gesehen hat der sich beim gebet nicht nach osten damals bei den christen europas üblich gewandt hätte francesco gabrieli hrsg die kreuzzüge aus arabischer sicht münchen aufl 1976 übers von kaltenbornstachau nenne die heiligen stätten die die drei religionen in jerusalem haben und erläutere ihre religiöse bedeutung vt d1 erkläre wie die entstehung des ersten kreuzzuges mit dem krieg der türkischen seldschukenherrscher zusammenhing vt d2 arbeite heraus mit welchen argumenten der papst seine zuhörer für die teilnahme am kreuzzug zu gewinnen suchte q2 beschreibe welche auswirkungen und erwartungen die papstrede bei den menschen hervorrief vt beschreibe den weg der kreuzfahrerheere und nenne die von ihnen gegründeten kreuzfahrerstaaten d2 erläutere dabei auch den unterschied zwischen ritterund bauernkreuzzug vergleiche die beiden berichte q3 und q4 daraufhin inwieweit sie sich gegenseitig bestätigen ergänzen oder widersprechen nachgefragt
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 2
Gehe bei deiner Antwort auf folgende Fragen ein:
– Welche Art von Krieg führten die türkischen Herrscher?
– Welches Gebiet eroberten sie?
– Warum fühlte sich der byzantinische Kaiser bedroht?
– Wie reagierte er?
– Welche Auswirkungen hatte seine Reaktion?
Drucken
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 6
a) Lege eine dreispaltige Tabelle an mit den Oberbegriffen „Bestätigung“, „Ergänzung“, „Widerspruch“
b) Lies nun die Texte vergleichend durch und trage in Stichworten unter „Bestätigung“ ein, was in beiden übereinstimmt, z. B. Ermordung vieler Muslime.
c) Verfahre genauso mit den Oberbegriffen „Ergänzung“ und „Widerspruch“.
Drucken
fenster zur welt q8 zusammenleben mit den muslimen ein christlicher augenzeuge berichtet 1127 über seine zeit im heiligen land wir die wir abendländer waren sind orientalen geworden dieser der römer oder franke war ist hier bewohner palästinas geworden jener der in frankreich in reims oder chartres wohnte betrachtet sich hier jetzt als bürger von tyrus oder antiochia wir haben schon unsere geburtsorte vergessen mehrere von uns wissen sie schon nicht mehr oder wenigstens hören wir sie nicht mehr davon sprechen manche von uns besitzen in diesem land häuser und diener die ihnen gehören ein anderer hat eine frau geheiratet die durchaus nicht seine landsmännin ist eine christliche syrerin oder armenierin oder sogar eine frühere muslimin die die gnade der christlichen taufe empfangen hat sie sprechen verschiedene sprachen und haben es doch alle schon fertiggebracht sich zu verstehen die verschiedensten mundarten sind jetzt der einen wie der anderen nation gemeinsam und das vertrauen nähert die entferntesten rassen einander an régine pernoud hrsg die kreuzzüge in augenzeugenberichten münchen aufl 1975 übers von hagen thürnau d3 die kreuzzüge und ihre folgen der historiker peter thorau beschreibt die folgen der kreuzzüge für christen und muslime so auf beiden seiten bewirkten die kreuzzüge eine verstärkte selbstbewusstwerdung durch die konfrontation mit den kulturell und religiös fremden gegnern während sie im orient jedoch angesichts der bedrohung durch die christlichen eroberer letztlich zu einer einigung der zerstrittenen muslimischen fürstentümer im zeichen des islam führten traten in europa verstärkt nationale züge gegenüber einem christlichen zusammengehörigkeitsgefühl in den vordergrund völlig unterschiedlich fällt denn auch die wahrnehmung der kreuzzüge aus obwohl aus militärischer sicht ein fehlschlag wurden sie von der älteren europäischen geschichtsschreibung häufig durchaus positiv gesehen ins kollektive gedächtnis der islamischen welt hingegen prägten sie sich als traumatisierendes tief erschütterndes ereignis ein das dem verhältnis zwischen islam und christen tum nachhaltigen schaden zufügte peter thorau die kreuzzüge münchen aufl 2012 versetze dich in die person des geistlichen q5 und formuliere eine gegenrede zur papstrede q2 beurteile wie sich die feindbilder q1 und q6 zueinander verhalten begründe warum kreuzfahrer und einheimische in palästina nicht zu einem miteinander fanden vt formuliere zu q7 und q8 je zwei fragen zum zusammenleben von christen und muslimen auf die die quellen eine antwort geben schreibe fragen und antworten auf erläutere die bedeutung der kreuzzüge für die europäischorientalischen handelsbeziehungen vt arbeite heraus worin der historiker die bedeutung der kreuzzüge sieht d3 erörtere ob die folgen der kreuzzüge für die beziehungen zwischen christen und muslimen eher positiv oder negativ einzuschätzen sind afb afb ii afb iii
Verstehen
Denkanstoß Aufgabe 7
Stelle in einer Tabelle die voneinander abweichenden Aus sagen gegenüber:
Fasse die Aussagen nun in einer Rede zusammen: Der Papst berichtet, Muslime hätten das Land von Jerusalem besetzt und schwere Untaten begangen. Ich aber frage euch: Muss man sie daher töten? Es ist doch klar, dass sie das Land nie bekommen hätten, wenn Gott es ihnen nicht … Der Papst behauptet ferner, Muslime seien … Das ist unwahr. Muslime sind …
Drucken
1000–1400 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt üben interaktiv 4z4h42 überprüfe dich selbsteinschätzungsbogen pw3ww2 die lebenswelt der mittelalterlichen stadt begriffe erklären sachkompetenz hier sind begriffe zum leben im mittelalter erklärt aber es haben sich dabei einige fehler eingeschlichen finde diese fehler und erkläre die begriffe richtig stadtluft macht frei rechtsgrundsatz nach dem bürger der städte an keine grundherrschaft leibeigenschaft gebunden sind patrizier bewohner der stadt deren familien schon zur römerzeit da lebten bürger bewohner der stadt mit allen rechten auch denen zur mitwirkung an der stadtregierung markt großer platz auf dem sich die bürger trafen um für ihre rechte zu demonstrieren zunft ort an dem die stadtbewohner zünftig bei bier und wein feierten schutzprivileg besonderes ausdrückliches schutzversprechen die mittelalterliche stadt eine geschichtserzählung ergänzen sachkompetenz methodenkompetenz ergänze die geschichtserzählung des ersten unterkapitels burger und baur scheydet nichts dann die maur mit kuno verwende dabei folgende situationen kuno erhält am marktplatz von einem patrizier informationen über die stadtregierung bekommt von einem fernhändler sein haus gezeigt und dessen geschäft erklärt fragt seinen onkel über die zünfte aus beobachtet jüdische bewohner und spricht mit ihnen die hanse einen lückentext lösen sachkompetenz schreibe den folgenden text in dein heft füge in die lücken das jeweils passende wort ein hanse hansestadt lübeck hansetag kogge konto re lagerhallen lübeck ostsee städtebund waren nur gemeinsam sind wir stark deshalb schlossen sich im mittelalter kaufleute zusammen in der ……………… wenn nötig half man sich und betrieb zum beispiel niederlassungen in fremden häfen die ……………… genannt werden dort fand der kaufmann ……………… oder ……………… um sein schiff zu entladen und ……………… zu lagern der bekannteste schiffstyp ist die ……………… mit ihr befuhr man die ……………… zum beispiel richtung dänemark die gewinne machten die heimatstädte wohlhabend deshalb unterstützte deren stadtrat diese zusammenschlüsse die hanse war deshalb auch ein ……………… wichtige beschlüsse traf man gemeinsam auf dem ……………… dieser fand häufig in der stadt statt die als ihr hauptort gilt ……………… dort ist man bis heute darauf stolz was man am kennzeichen der autos erkennt hl–……………… rechte in der mittelalterlichen stadt sprichwörter analysieren und überprüfen sachkompetenz reflexionskompetenz macht stadtluft frei und gleich versetzt euch in die lage unterschiedlicher stadtbewohner und beantwortet diese frage beginnt jeweils so ja das stimmt denn oder nein das stimmt nicht denn besetzt folgende rollen patrizier zunftmeister handwerksgeselle tagelöhner frau eines handwerksmeisters gaukler lehrling das sprichwort burger und baur scheidet nichts dann die maur ist in der kapitelüberschrift auf mit einem fragezeichen versehen entscheide ob der unterschied zwischen stadtund landbevölkerung
wiederholen und anwenden tatsächlich so vereinfacht ausgedrückt werden kann gehe dabei auf folgende fragen ein was sagt das sprichwort aus wodurch unterscheiden sich wirtschaftliche tätigkeiten und die rechte der stadtbewohner im vergleich zu den bauern frauen in der stadt eine bildquelle analysieren sachkompetenz methodenkompetenz reflexionskompetenz interpretiere q1 nach den vorgaben des kompetenztrainings auf 18/19 halte deine ergebnisse zu allen drei schritten schriftlich fest bei schritt analysieren hilft es dir wenn du das bild langsam in einer richtung von links nach rechts oder von oben nach unten durchgehst ein trick dafür du kannst das bild erst mit einem papier abdecken und dieses dann langsam in einer richtung vom bild wegziehen aufruf zum kreuzzug eine abbildung kommentieren sachkompetenz methodenkompetenz reflexionskompetenz q1 kaufmannsfamilie in ihrer wohnung nachträglich kolorierter holzschnitt 1476 q2 papst urban ii. ruft zum kreuzzug auf auf dem banner in der bildmitte stehen die worte deus vult gott will es nachträglich kolorierter holzschnitt um 1480 beschreibe der reihe nach wo wann und warum das dargestellte ereignis stattgefunden hat schildere welche folgen es hatte schreibe im namen des englischen mönchs radulfus niger vgl q5 einen protestbrief an den papst
auf einen blick fachmethode sachquellen analysieren band 5/6 seite 20/21 arbeitsschritte kompetenztraining fachmethode suche zu hause den ältesten gegenstand, den du transportieren kannst analysiere ihn dann mithilfe der arbeitsschritte und verschaffe dir alle zusatzinformationen, die du brauchst erstelle als auswertung einen kurzen „steckbrief“, in dem du die wichtigsten ergebnisse für deine mitschülerinnen und mitschüler zusammenfasst unter dem code (s. rechts) fi ndest du eine vorlage dafür gestaltet mit euren sachquellen eine kleine ausstellung nachgefragt arbeitsschritte 1. beschreiben 2. analysieren 3. deuten stelle fest, um welchen gegenstand es sich handelt sieh ihn an, nimm ihn in die hand, probiere ihn aus beschreibe seine besonderheiten beantworte die folgenden fragen aus welchen materialien ist der gegenstand aus welcher zeit stammt er ver mutlich wozu diente er wie wurde er gehandhabt und von wem dafür musst du dir unter umständen zusätzliche informationen aus lexika, sachbüchern, dem internet oder von experten besorgen. als experten können oft ältere menschen dienen überlege, was du aus dem gegenstand über das leben von menschen früher entnehmen kannst. welche bedeutung hatte er für sie? notiere fragen die sich an den gegenstand an knüpfen und zu deren beantwortung du weitere informationen brauchst stelle abschließend fest, ob der gegenstand für unser heutiges leben noch eine rolle spielt. ist er durch andere ersetzt worden was lässt sich daraus über die lebensweise der menschen und ihren wandel ablesen q3 hohles bügeleisen eine andere möglichkeit, ein bügeleisen warm zu halten, bestand darin, in ein hohles bügeleisen ein erhitztes eisenstück einzuschieben man konnte diese eisenstücke austauschen. sie ließen sich unmittelbar im feuer erhitzen; schmutz machte nichts aus, weil die eisenstücke nicht direkt mit der wäsche in berührung kamen länge: 19,5 cm breite: 9 cm höhe: 18 cm gewicht insgesamt: 3,56 kg gewicht der einlage: ca. 1,27 kg afb ii: 1, 2 afb iii: 3 info vorlage steckbrief mh2k88 verfassertexte auswerten band 5/6 seite 28/29 arbeitsschritte kompetenztraining fachmethode arbeitsschritte 1. überblick verschaffen 2. analysieren 3. zusammenfassen lies den ganzen text einmal zügig durch. um welches thema und um welche fragestellungen geht es notiere eine überschrift und stichworte auf deinem arbeitsblatt finde begriffe, mit denen du den text gliedern kannst notiere die wichtigsten gedanken eines jeden abschnitts. zum beispiel: welche ereignisse und entwicklungen werden genannt wer sind die handelnden; wie werden sie bewertet analysiere, wie der verfasser seine informationen und argumentationen sprachlich darbietet. zum beispiel: zeitliche bezüge werden ausgedrückt durch „vorher“, „nachher“ oder plötzlich“; begründungen durch „weil“, „deswegen“; gegensätzliche wertungen oder widersprüche durch „einerseits – andererseits“, „obwohl“, „manche meinen“; unsicherheit oder vorbehalte durch „vielleicht vermutlich“, „wahrscheinlich fasse die wichtigsten informationen des textes knapp zusammen und bringe sie in eine eigene form. dafür kannst du zum beispiel den inhalt des textes in wenigen eigenen sätzen formulieren eine stichwortliste erstellen etwa mit einander widersprechenden argumenten oder wertungen eine tabelle gestalten die aussage des textes in einer strukturskizze wiedergeben darstellungsweise es ist nicht ganz sicher, ab wann wir von „menschen“ sprechen können. das wird schon in der überschrift deutlich deswegen ist auch von menschenartigen wesen die zusammenfassen zum schluss solltest du die wichtigsten erkenntnisse in einigen wenigen sätzen zusammenfassen. du könntest zum beispiel folgendes aufschreiben in afrika wurde
glossar kompetenztraining rekonstruktionszeichnungen analysieren band 5/6 seite 44/45 arbeitsschritte kompetenztraining fachmethode arbeitsschritte 1. beschreiben 2. analysieren 3. deuten stelle fest, worum es bei der rekonstruktionszeichnung geht die bildlegende gibt dir dazu informationen handelt es sich um einen einzelnen gegenstand, ein bauwerk eine historische szene, … ordne das thema in zeit und raum ein überlege, was du bereits über das thema weißt welche gegenstände sind zu sehen welche baulichen oder technischen einzelheiten kannst du erkennen was kannst du über die funktionsweise aussagen welche personen sind abgebildet welche tätigkeiten üben sie aus welche darstellungsweise wurde gewählt: farbig oder schwarz-weiß, einige wenige dinge oder viele details, welche perspektive geht es um sachinformation oder um atmosphäre und dramatik was sagt die rekonstruktionszeichnung über das thema aus ist erkennbar, was man über das thema tatsächlich weiß und wo ergänzungen vorgenommen wurden? woran erkennst du das was würdest du möglicherweise an der rekonstruktionszeichnung kritisieren? begründe deine kritik ein mann stellt durch abschlagen ein steinwerkzeug her, ein kind schaut ihm dabei zu eine frau pfl ückt beeren ein mann trägt ein schwein heran, das er mit einem speer erlegt hat zwei menschen graben nach wurzeln oder knollen ein mann glättet einen speer eine frau säubert ein aufgespanntes fell ein mensch errichtet ein zeltgerüst aus stangen, zwei andere legen weitere stangen und häute bereit eine frau vernäht ein fellstück eine frau trägt gesammeltes feuerholz heran eine frau trägt essbare blätter oder gräser alle menschen tragen kleidung aus fellen das bild stellt eine alltagssituation dar. es passiert nichts dramatisches. es geht nicht um atmosphäre, sondern um information. die personen bilden eine gruppe, einzelne werden nicht genauer dargestellt, sie sind austausch bar deuten die rekonstruktionszeichnung soll die lebensgewohnheiten und alltagstechniken der jäger und sammler verdeutlichen. dazu fasst sie möglichst viele von ihnen zusammen. das bild zeigt also keine echte lagerszene, sondern eine künstlich verdichtete tatsächliches wissen und vermutungen sind auf dem bild nicht unterscheidbar. eine reihe von details sind sehr einfach oder modern dargestellt, etwa der sehr geradlinige bachlauf oder das fehlen von unterholz im wald fasse die informationen, die dir die zeichnung gibt, mithilfe der folgenden begriffe zusammen lebensbereiche – wohnen – kleidung – ernährung – werkzeuge/waffen – gefäße/aufbewahrung – natur/landschaft erzähle zu dem bild eine geschichte wähle dazu eine figur aus und schildere ihren tagesablauf. welche arbeiten mussten erledigt werden welche aufgaben und pfl ichten gab es? wie würden die bilder zu anderen jahreszeiten aussehen nachgefragt afb i: 1 afb ii: 2 schaubilder analysieren band 5/6 seite 66/67 arbeitsschritte kompetenztraining arbeitsschritte 1. thema erfassen 2. analysieren 3. deuten stelle fest, welches thema das schaubild behandelt. die unterschrift hilft dir dabei ordne das thema in raum und zeit ein. manche schaubilder geben zustände wieder, die nur für kurze zeit oder nur für einzelne länder galten. andere zeigen lange zeit geltende typische merkmale stelle fest, welche bestandteile das schaubild hat. das können zum beispiel kästchen, kreise linien, pfeile, figuren oder zeichen sein analysiere, wofür die verwendeten symbole, formen, farben und zeichen auf dem schaubild stehen überlege, welchen zusammenhang es zwischen dem thema und der form des schaubildes gibt arbeite heraus, wie die einzelnen bestandteile miteinander verknüpft sind und was das bedeutet: stehen sie z. b. nebeneinander oder untereinander oder sind sie mit pfeilen verbunden erkläre, welches verhältnis zwischen personen oder menschengruppen durch das schaubild deutlich wird fasse zusammen, was du über das dargestellte thema erfahren hast deuten an der spitze der ägyptischen gesellschaft steht der pharao. er bestimmt allein über alle anderen. daher steht er ganz oben an der spitze des schaubildes. von oben nach unten wird nun das schaubild immer breiter. das sagt etwas aus über die anzahl der menschen die zu den schichten gehören. zum beispiel gibt es viel mehr bäuerinnen und bauern als beamte und schreiber. die pfeilrichtungen sagen aus dass anordnungen und befehle immer von den oberen schichten ausgingen. über die pfl ichterfüllung wird von unten nach oben berichtet einige hatten auch das recht und die pfl icht, die hohen beamten zu beraten. außerdem wird deutlich, dass allen mitgliedern der ägyptischen gesellschaft schutz und fürsorge durch den pharao zugesichert wurden das schaubild zeigt dass es in ägypten eine rangordnung gab in der jeder seinen festen platz hatte und menschen einander über- und untergeordnet waren. für einen solchen gesellschaftsaufbau gibt es einen begriff die hierarchie . er kommt aus dem griechischen und bedeutet „heilige ordnung“. er wird auch heute noch in der politik und wirtschaft gebraucht fachmethode
auf einen blick kompetenztraining nachgefragt fachmethode lies die anleitung zu den drei arbeits schritten noch einmal. arbeite heraus, welche der schritte du anhand des textes q1 umsetzen kannst und für welche du zusatzinformationen brauchst schreibe einen brief an otanes mega byzos oder dareios, in dem du aus heutiger sicht auf die frage nach der besten staatsform antwortest in herodots text endet die diskussion schließlich damit, dass die meisten zuhörer die argumente des dareios am überzeugendsten fi nden – dieser teil ist nicht mehr abgedruckt. erörtert diesen ausgang analysieren herodot lebte von 486–424 v. chr. er war ge schichts schreiber er ließ sich auf seinen reisen erzählen, was die leute über die vergangenheit wussten, und schrieb das wichtigste auf. zu herodots zeit gab es in den griechischen poleis alle regierungsformen herodot ist nicht einseitig, denn er lässt alle meinungen zu wort kommen und überlässt das urteil dem leser im text kommen immer wieder die drei begriffe demokratie, oligarchie und monarchie vor; das sind die schlüsselbegriffe. herodots absicht ist es, die leser zum nachdenken über diese staatsformen zu bringen deuten die griechen haben die demokratie „erfunden“, vor allem in athen war man stolz darauf. aber es gab auch viel kritik daran. manchmal schien es, als ob die anderen staatsformen besser funktionierten herodots quelle ist sehr wichtig für uns, weil er uns zeigt, wie damals über politik diskutiert wurde herodot stellt die verschiedenen staatsformen mit ihren vor- und nachteilen gut dar. bestimmt haben die athener mit ihrer demokratie etwas sehr gutes erfunden. es ist richtig, wenn möglichst alle mitbestimmen können. aber herodot zeigt auch, dass selbst die demokratie probleme bereiten kann arbeitsschritte 1. beschreiben 2. analysieren 3. deuten lies den text genau durch und stelle zunächst fest, worum es geht. achte dabei auf die genannten personen sowie die orts- und zeitangaben kläre alle begriffe, die du nicht verstehst, mit einem wörterbuch oder frage deine lehrerin/deinen lehrer unterteile den text in sinnabschnitte und formuliere für jeden eine zusammenfassende überschrift stelle fest, wer den text geschrieben hat. angaben zum verfasser fi ndest du in der einleitung der quelle, manchmal auch in begleitenden texten kläre, mit welchem zeitlichen abstand zum geschehen der verfasser geschrieben hat und woher er seine kenntnisse hatte so kannst du besser einschätzen wie gut der verfasser informiert war untersuche, ob der verfasser einseitig oder mit einem bestimmten interesse geschrieben hat: erkennst du wertungen in seinem text? vertritt er eine bestimmte meinung gibt es bestimmte schlüsselbegriffe, die der verfasser ver wendet ordne die quelle in einen größeren geschichtlichen zusammenhang ein. dazu kannst du den verfassertext zu hilfe nehmen formuliere nun eine einschätzung: warum ist die quelle für das thema wichtig? welche wichtigen informationen gibt sie uns formuliere zum schluss deine eigene deutung des historischen sachverhalts unter einbezug der quelle und anderer informationen überlege: gibt es fragen, die offen bleiben afb ii: 1, 2 afb iii: 3 textquellen analysieren band 5/6 seite 98/99 arbeitsschritte geschichtskarten analysieren band 5/6 seite 120/121 arbeitsschritte kompetenztraining fachmethode stadt der griechen war kyme. mithilfe der maßstabsleiste lässt sich erkennen, dass das gebiet der griechen nur wenige kilometer ins landes innere hineinreichte. kyme und neapolis, das heutige neapel, waren wie eine insel: auf der einen seite umgeben vom meer, landwärts vom etruskischen gebiet. die griechischen stadtstaaten waren handelsstädte, ausgerichtet auf das meer das gebiet der etrusker stellte hingegen eine fl ächenmäßig größere einheit dar. die nord-süd-ausdehnung des etruskischen herrschaftsgebiets betrug mehr als 500 kilometer auf dem gebiet der etrusker lagen die meisten städte: sowohl an der küste als auch im landesinneren keine dieser städte ist als hauptstadt gekennzeichnet norden beherrschten die etrusker das land deuten zusammenfassend lässt sich festhalten, dass italien im 6. jahrhundert v. chr. in ganz unterschiedliche gebiete aufgeteilt war. in nord- und mittelitalien beherrschten die etrusker ein großes gebiet. zahlreiche städtegründungen gehen auf sie zurück das gebiet der italiker war hingegen eher ländlich geprägt und verzeichnete keine städte. die verschiedenen volksgruppen der italiker lebten als bauern die griechischen stadtstaaten in süditalien glichen in iharbeitsschritte 1. beschreiben 2. analysieren 3. deuten beschreibe das thema der karte nenne den zeitraum, der mit der karte dargestellt wird bestimme den ausschnitt, den die karte zeigt halte fest, ob die karte eher einen zustand oder eine entwicklung darstellt (bspw gebietsveränderungen arbeite die wichtigen informationen, die du der karte entnehmen kannst, heraus halte fest, welche einzelheiten dir besonders auffallen prüfe, welche informationen der karte du in verbindung mit deinem bisherigen wissen bringen kannst fasse die aussagen der karte in wenigen sätzen zusammen erläutere, welche längerfristigen entwicklungen oder auch konfl ikte sich an der karte ablesen lassen überlege dir, auf welche fragen die karte keine antwort gibt
glossar kompetenztraining bildquellen analysieren band seite 18/19 arbeitsschritte kompetenztraining nachgefragt fachmethode beschreibe noch einmal in eigenen worten, wie die könige und kaiser des mittelalters ihre stellung sahen verwende dazu auch die informationen aus dem vt auf seite 14/15 ergänze auf einer kopie des bildes eine sprech- oder denkblase für eine figur. lasse sie einen treffenden satz sagen oder denken, der in die zeit passen würde erkläre: was konntest du bei deiner bildanalyse selbst erschließen, wofür brauchtest du zusatzinformationen musterlösung beschreiben das bild zeigt otto iii. als kaiser. es ist eine mittelalterliche buchmalerei, die um etwa 1000 entstand. das buch aus dem das bild stammt, wurde von mönchen aus dem kloster reichenau geschaffen. es ist zu sehen, wie eine person die von einer frauenfi gur getragen wird von oben her eine krone aufgesetzt bekommt sie sitzt in einem mandelförmigen umriss. um sie herum befi nden sich gefl ügelte wesen und einige menschen vermutlich untergeordnete herrscher und untertanen. das bild macht einen edlen eindruck. es sieht sehr geordnet aus alles scheint seinen platz zu haben. die herausgehobenheit der gekrönten person in der bildmitte ist ganz klar analysieren das bild hat einen purpurfarbenen rahmen. die figuren sind vor einem goldenen hintergrund dargestellt im zentrum des oberen bilddrittels sitzt kaiser otto iii in einer mandorla. diese ist wie eine art heiligenschein zu verstehen. otto hält in seiner rechten hand den reichsapfel als zeichen für weltherrschaft. die frauengestalt die ihn mit seinem thron trägt, stellt die erde dar. eine von oben kommende hand setzt otto die krone auf das haupt. das versinnbildlicht die krönung des herrschers durch gott selbst. otto scheint überhaupt gott sehr nahe zu sein: die ihn umgebenden vier figuren mit flügeln im oberen bilddrittel stehen für die evangelisten matthäus mensch markus löwe johannes adler und lukas stier). sie tragen gemeinsam die heilige schrift, also die bibel. bei den gekrönten personen links und rechts des kaisers handelt es sich um hochstehende herrscher, die sich otto gesenkten blickes demütig zu neigen. im unteren bilddrittel stehen zwei krieger oder ritter (links) mit lanze und schild sowie zwei geistliche, wahrscheinlich bischöfe deuten das bild drückt aus, dass der kaiser sich anderen gekrönten herrschern bildmitte übergeordnet sah er stand sozusagen über aller weltlichen und geistlichen gewalt unteres bilddrittel). seine position ist dem himmel ganz nahe, er wirkt selbst beinahe wie ein gott, weil er hoch oben fast zu schweben scheint und ihn alle so verehren die menschen sollten glauben, der kaiser werde direkt von gott eingesetzt. dafür lernten wir schon den begriff gottesgnadentum arbeitsschritte 1. beschreiben 2. analysieren 3. deuten erfasse, welches thema das bild hat ordne das bild einer bildgattung zu stelle fest: wann, wo und unter welchen umständen ist es entstanden beschreibe, was du siehst (ohne schon zu viel zu erklären schildere, wie das bild auf dich wirkt erkläre den bildaufbau. verwende dazu geeignete formulierungen (im vordergrund … im hintergrund …, am unteren bildrand …, in der bildmitte … und achte auf die darstellung und positionierung von personen oder dingen auf dem bild analysiere nun im detail, was zu sehen ist. was bedeuten die personen, gegenstände, … überlege, wofür das bild steht erläutere, wie es mit deinem historischen wissen in verbindung gebracht werden kann erfasse die botschaft des bildes und erläutere sie afb i: 1 afb ii: 2, 3 bauwerke analysieren band seite 56/57 arbeitsschritte kompetenztraining fachmethode 3) das gebäude dürfte ursprünglich im auftrag des bischöfl ichen stadtherrn errichtet worden sein später wurde es von der bürgerschaft um- und ausgebaut 4) die baukosten sind entsprechend vom auftraggeber also dem bischof bzw später den bürgern getragen worden 5) von der baugeschichte liegt noch immer vieles im dunkeln. erwiesen ist, dass das gebäude seit 1200 mehrfach erweitert, an- und umgebaut worden ist deuten 1) das rathaus zeigte jedem besucher der stadt: bischof und bürgerschaft sind „auf der höhe der zeit“. das prachtvolle gebäude stellte den wohlstand und die baukunst arbeitsschritte 1. beschreiben 2. analysieren 3. deuten stelle fest, um was für ein gebäude es sich handelt und wann es errichtet wurde beschreibe die lage des bauwerkes in der stadt und suche eine erklärung dafür bestimme die maße des gebäudes, also länge, breite und höhe benenne einzelne teile des bauwerkes und stelle fest, in welchem baustil es erbaut wurde bestimme anhand der einzelnen bestandteile und räume die funktion des bauwerkes informiere dich, wer das bauwerk errichten ließ und aus welchem anlass erkundige dich, wer die bauarbeiten bezahlt hat analysiere die baugeschichte wurden z. b. teile nachträglich an- oder umgebaut? welche gründe gab es dafür stelle vermutungen an, wie das bauwerk auf die menschen wirkte und welche absichten der erbauer damit verfolgte triff aussagen über den heutigen verwendungszweck. hat er sich geändert, dann erkläre warum q2 spätmittelalterlicher baubetrieb um 1390 dargestellt ist das biblische motiv des turmbaus zu babel in einer handgeschriebenen prachtbibel
auf einen blick kompetenztraining fachmethode ergänze die fehlenden teile der musterlösung bei den teilschritten analysieren“ und „deuten“. nutze die symbollegende im buch dazu. weitere hinweise für die analyse fi ndest du im internet (s. code versuche, die pose und die position ludwigs xiv. mit mitschülern nachzustellen. beschreibe selbst, wie es auf dich wirkt, und lass die anderen ihre eindrücke schildern verfasse einen brief, in dem ludwig dem maler rigaud seine vorstellungen von der aussage des herrscherbildes mitteilt nachgefragt afb i: 2 afb ii: 3 afb iii: 1 arbeitsschritte 1. beschreiben 2. analysieren 3. deuten halte deinen ersten eindruck von dem bild fest stelle fest, was dir besonders ins auge fällt nenne einzelheiten, die du auf dem bild erkennst finde heraus, um wen es sich auf dem bild handelt kläre, wie die herrscherfi gur dargestellt wurde. analysiere die anordnung auf dem bild körperhaltung, gesten und mimik, blickrichtung und kleidung die perspektive des künstlers beim malen herrschaftssymbole und deren bedeutung künstlerische mittel wie farben, lichtwirkung, größe format informiere dich über den künstler, die entstehung des bildes und seine verwendung formuliere zusammenfassend die wirkung, die das bild deiner meinung nach bei den zeit genossen und späteren gene rationen erzielen sollte erkläre, welcher herrschaftsanspruch in dem bild deutlich wird musterlösung beschreiben sofort fällt der große, prächtig gekleidete mann im mittelpunkt auf, der auf einem podest stehend einen großen teil des bildes ausfüllt. er stützt sich auf einen stab und an seiner linken seite trägt er ein schwert. hinter ihm steht ein vergoldeter thron. über diesem wölbt sich ein mit goldkordeln verzierter stoff. zu seiner rechten befi ndet sich ein kleiner tisch mit einem kissen. im hintergrund erkennt man eine säule, deren sockel mit einem relief versehen ist. das bild ist von einem vergoldeten geschnitzten rahmen mit einer krone umgeben analysieren auf dem bild ist der französische könig ludwig xiv. zu sehen. der betrachter schaut zu ihm auf. ludwigs körperhaltung strahlt tatkraft und eleganz aus … der hofmaler des königs, hyacinthe rigaud, gestaltete 1701/02 dieses porträt in lebensgröße. es war ursprünglich für den spanischen könig philipp v. gedacht, einen enkel ludwigs xiv. doch es gefi el ludwig xiv. so gut, dass er es behielt und für philipp in rigauds werkstatt eine kopie anfertigen ließ. das bild fand seinen platz im thronsaal von versailles deuten das bild macht jedem betrachter unmissverständlich klar dass dieser herrscherpersönlichkeit eine besondere bedeutung zukommt. dieser eindruck wird … herrscherbilder analysieren band seite 150/151 arbeitsschritte kompetenztraining fachmethode arbeitsschritte 1. beschreiben 2. analysieren 3. deuten beschreibe die gezeichneten personen, tiere und gegenstände möglichst genau. achte darauf, in welcher beziehung sie zueinander stehen wenn eine beschriftung vorhanden ist, ein titel, eine bildunterschrift, sprechblase oder ähnliches, lies sie gründlich und stelle eine beziehung zu der darstellung her analysiere, welches thema die karikatur hat analysiere, wen oder was die einzelnen personen und figuren darstellen informiere dich über den geschichtlichen hintergrund abgebildete personen, entstehungszeit, karikaturist, ort der veröffentlichung, adressatenkreis. manche angaben fi ndest du in deinem geschichtsbuch andere in lexika oder im internet stelle fest, welche meinung oder kritik in der karikatur deutlich wird. was wollte der zeichner ausdrücken stelle vermutungen darüber an, ob die aussage, die in der karikatur steckt, für die zeitgenossen leicht zu verstehen war nimm stellung zu der aussage der karikatur ein adliger, lässt sich ebenfalls von dem bauern tragen obwohl es drei „gruppen“ von menschen gibt, ruht auf dem bauern die gesamte last die tiere am boden zeigen, mit welchen problemen der bauer außerdem zu kämpfen hat. die tiere dürfen seine ernte auffressen. jagen dürfen nämlich nur die vertreter der beiden anderen stände abgebildet sind keine bekannten personen, sondern drei menschen, die stellvertretend für ihren stand dargestellt sind. die karikatur ist 1789 entstanden, der zeichner ist unbekannt. es gab aber viele ähnliche karikaturen, auf dedeuten die karikatur kritisiert die lage in frankreich; das zeigt auch die bildunterschrift: das „spiel“ muss bald ein ende haben. der zeichner fi ndet es ungerecht, dass ein stand nämlich der dritte stand, die beiden anderen ernähren muss, obwohl sie kräftig, gesund und wohlhabend sind der dritte stand geht daran fast zugrunde – so zeigt es die darstellung die karikatur war vermutlich für die franzosen in dieser zeit leicht zu verstehen. sie haben die drei männer schnell als repräsentanten der drei stände erkennen karikaturen analysieren band seite 170/171 arbeitsschritte
glossar kompetenztraining verfassungsschaubilder analysieren band seite 182/183 arbeitsschritte kompetenztraining fachmethode der französische revolutionär robespierre stellte in einer rede am 2. januar 1792 die frage: „gleicht denn die verfassung, von der man sagt sie sei die tochter der erklärung der menschen- und bürgerrechte, wirklich noch ihrer mutter?“ beurteile diese aussage ( d1 nachgefragt afb iii: 1 nationalversammlung befi ndet sich das symbol eines paragraphen stellvertretend für die gesetzgebung zur judikative, also der recht sprechenden gewalt, gehörten die gerichtshöfe, die sich aus den gewählten richtern und geschworenen zusammensetzten zwischen den in den kästchen genannten institutionen gibt es pfeile, die auf beziehungen zwischen den einzelnen institutionen hinweisen die nationalversammlung berief die gerichtshöfe ein und kon trollierte sie. der könig besaß ein vetorecht gegen die von der nationalversammlung beschlossenen gesetze die nationalversammlung wiederum kontrollierte die minister. könig sowie nationalversammlung hatten gemeinsam den oberbefehl über die streitkräfte deuten die verfassung von 1791 war ein ergebnis der französischen revolution. sie war insofern selbst revolutionär als der zuvor absolut herrschende monarch nunmehr an eine verfassung gebunden war. frankreich war somit eine konstitutionelle monarchie geworden darüber hinaus gab es ein parlament, die nationalversammlung, das von den bürgern gewählt wurde. auch beamte und richter wurden nunmehr gewählt trotz des revolutionären aufbruchs existierte die monarchie jedoch weiter und der könig erhielt weitreichende machtbefugnisse: er ernannte und entließ die minister besaß – gemeinsam mit der nationalversammlung – den oberbefehl über das militär und konnte ein veto gegen die beschlüsse des gewählten parlaments einlegen angesichts der revolutionären ereignisse von 1789 und der erklärung der menschenrechte verwundert es, dass nur eine minderheit des volkes das wahlrecht besaß. es handelte sich nicht um ein allgemeines wahlrecht , denn das zensuswahlrecht schloss die jungen und besitzlosen männer sowie alle frauen von der politischen mitsprache aus. die analyse des verfassungsschemas lässt vermuten dass nicht alle revolutionäre, vor allem nicht die sansculotten mit dieser verfassung zufrieden waren aufgrund des königlichen vetorechts waren zudem konfl ikte zwischen dem könig und der nationalversammlung zu erwarten. es ist daher nicht überraschend, dass die revolution nach 1791 weiter ging und die verfassung nur kurze zeit in kraft blieb arbeitsschritte 1. beschreiben 2. analysieren 3. deuten beschreibe den aufbau und die graphischen elemente des schaubildes (farbigkeit symbole, pfeile, aufteilung nenne das land, für das die verfassung gelten soll recherchiere wenn nötig zusatzinformationen, z. b wann ist die verfassung in kraft getreten wie lange und für welchen geographischen raum war sie gültig wer hat sie beraten und beschlossen analysiere, welche bestandteile das schaubild hat und was sie bedeuten erläutere die bedeutung der verschiedenen elemente (pfeile farben, symbole überprüfe, wer wählen darf und wer nicht, wer gewählt wird und wer nicht erläutere, welche aufgaben und rechte die einzelnen institutionen haben analysiere, welche beziehungen es zwischen diesen institutionen gibt überprüfe, wie die macht in dieser verfassung verteilt ist stelle fest, um welche staatsform es sich handelt formuliere ein urteil darüber wie demokratisch deiner meinung nach die verfassung ist stelle vermutungen darüber an ob alle mit dieser verfassung zufrieden sein konnten oder ob sie anlässe für konfl ikte bietet
auf einen blick kompetenztraining arbeitstechnik gestalte eine zeitleiste zur geschichte deiner familie. überlege welche daten und ereignisse dir selber dazu einfallen. unterhalte dich auch mit deinen eltern und/oder großeltern darüber ordne in deine zeitleiste familienund orientierungsdaten aus der all gemeinen geschichte ein. deine familien zeitleiste wird besonders gut aussehen, wenn du auch noch kopien von fotos einklebst nachgefragt arbeitsschritte 1. planung 2. zeitleistenbausteine 3. ausgestaltung legt thema und zweck der zeitleiste fest berechnet maßstab und platzbedarf tragt die zeitskala ein und nehmt die markierung von abschnitten vor besprecht untereinander, zu welchen ereignissen, personen oder begriffen ihr eintragungen vornehmen wollt (am besten dann, wenn ein thema im unterricht abgeschlossen ist schreibt eure texte vor und besprecht sie miteinander sammelt passende bilder und andere zusätzliche materialien trefft daraus gemeinsam eine auswahl und formuliert unterschriften klärt genau, wo welcher „baustein“ in der zeitleiste hinkommen soll; tragt, klebt oder malt dann ein, was ihr geplant habt überlegt gemeinsam, welche verzierungen ihr noch vornehmen könnt (farben, symbole afb ii: 2 afb iii: 1 d2 zeitleiste zum leben des fritz 1902–1974 1924 erste lehrerstelle an der zwergschule 1970 karneval mit enkelkindern 1903 beim fotografen 1944 soldat in russland 1900 1920 1930 1950 1960 1910 1940 1970 1902 geburt 1974 tod arbeitstechnik eine zeitleiste erstellen band 5/6 seite 16/17 arbeitsschritte kompetenztraining arbeitstechnik arbeitsschritte 1. informationen sammeln 2. informationen ordnen 3. lernplakat gestalten teilt euch in gruppen zu den angebotenen themen auf jede gruppe sammelt informationen zu ihrem thema. fündig werdet ihr in diesem buch, in lexika und im internet. haltet die informationen schriftlich fest überlegt schon vor und während des sammelns, welche informationen für euch wichtig sind teilt euch ein, wer nach welchen informationen sucht sichtet die notizen und sammelt all jene mit wichtigen informationen zu eurem thema klärt gemeinsam, welche daten personen, begriffe und ereignisse für euer thema wichtig sind und was jemand unbedingt wissen muss ordnet die informationen ausgesuchten teilthemen zu fertigt zunächst eine skizze an auf der ihr die einzelnen elemente des plakates plant und zuordnet überlegt, wo und in welcher größe ihr texte und bilder platzieren wollt. bedenkt, dass euer plakat nicht zu voll werden sollte gestaltet dann euer plakat. benutzt verschiedene farben und bildmaterialien. denkt an eine gut lesbare schrift ein lernplakat erstellen martin luther johannes calvin und karl wer war wer in der zeit der reformation 1. informationen sammeln teilt euch in gruppen auf und erarbeitet pro gruppe eine der oben genannten personen. jede gruppe sammelt informationen zu ihrer person und macht sich dazu notizen fündig werdet ihr in diesem buch auf den seiten 116–129 schlagt auch im lexikon nach und recherchiert im internet oder in der schulbibliothek 2. informationen ordnen sichtet eure notizen und stellt die wichtigsten informationen zur person zusammen. orientiert euch dabei an 3. lernplakat gestalten skizziert zunächst auf einem blatt papier, wie euer lernplakat aussehen soll ihr könnt das plakat wie einen steckbrief zu der person anlegen die überschrift nennt den namen und die lebensdaten dann listet ihr tabellarisch wichtige stationen im leben der person auf sucht schließlich einen geeigneten ort für das porträt der person, vielleicht direkt unter der überschrift ergebnisse präsentieren lernplakate und gallery walk band seite 114/115 arbeitsschritte
glossar kompetenztraining arbeitsschritte 1. think: arbeite allein 2. pair: arbeite mit einem partner 3. share: tauscht euch in der gruppe/klasse aus lies dir deine aufgabe genau durch analysiere das material entsprechend der aufgabe halte deine ergebnisse in form von notizen fest beachte in allen arbeitsphasen die zeitvorgabe deiner lehrerin bzw. deines lehrers stellt euch gegenseitig eure ergebnisse vor der jeweils zuhörende notiert sich das wichtigste falls ihr dieselbe aufgabe gehabt habt: tauscht euch noch einmal darüber aus und verständigt euch auf ein gemeinsames ergebnis bei verschiedenen aufgaben stelle die ergebnisse deines partners in der gruppe/klasse vor bei gleichen aufgaben: stellt gemeinsam eure partnerergebnisse in der gruppe/klasse vor haltet in der gruppe/klasse das gemeinsame ergebnis in geeigneter form fest habt ihr euch zunächst in gruppen ausgetauscht, so verständigt euch abschließend in der klasse über die arbeitsergebnisse gestaltet eine geeignete präsentation eures arbeitsergebnisses erster arbeitsschritt: think in diesem arbeitsschritt beschäftigst du dich alleine mit einer aufgabe das kann die untersuchung eines verfassertextes oder einer quelle oder die auswertung von bildern und karten aus dem schulbuch sein. für diesen schritt steht dir eine bestimmte zeit zur verfügung. inner oder einer lernpartnerin aus das wird meist dein sitznachbar oder deine sitznachbarin sein. er oder sie hat dieselbe oder eine etwas andere aufgabe erhalten. ihr stellt euch gegenseitig vor, was ihr herausgefunden habt frage nach wenn dir etwas nicht klar ist. widersprich wenn du anderer meinung bist. macht euch während eugemeinsam lernen mit thinkpairshare lernen band 5/6 seite 34/35 arbeitsschritte ein rollenspiel entwickeln bei einem rollenspiel im fach geschichte versetzt ihr euch in eine person der vergangenheit und stellt deren verhalten in einer historischen situation nach. das macht spaß und hilft euch, das leben und handeln von menschen aus früheren zeiten besser zu verstehen. wie so ein rollenspiel genau abläuft, erfahrt ihr hier was ihr durch rollenspiele lernen könnt im fach geschichte geht es fast immer darum, personen zu verstehen, die in situationen der vergangenheit handeln. diese wichtige kompetenz kann durch rollenspiele gefördert werden. denn in rollenspielen versetzt ihr euch in die handelnden personen und nehmt deren perspektive ein. das hilft euch, andere personen besser zu verstehen – nicht nur in der geschichte unterschiedliche arten es gibt verschiedene arten von rollenspielen. sie unterscheiden sich vor allem darin, wie frei ein spieler bei der gestaltung seiner rolle ist. einen recht großen freiraum habt ihr wenn ihr personen oder situationen der vergangenheit ohne anbindung an ein konkretes ereignis darstellt. wichtig ist hier, aus dem typischen zeitkontext heraus zu handeln, also sich so zu verhalten, wie es für die epoche und die damalige situation üblich war noch enger an die historische situation seid ihr gebunden, wenn ihr bestimmte szenen und personen, die historisch durch quellen oder wissenschaftliche darstellungen verbürgt sind möglichst genau nachspielen wollt hier muss der inhalt des spiels zuerst sorgfältig erarbeitet werden. das gilt auch, wenn ihr entscheidungssituationen nachspielt, deren personen und umstände ihr zwar kennt, nicht aber deren ausgang, z. b. den beschluss einer griechischen volksversammlung bei einem scherbengericht. hier muss anschließend die entscheidung im spiel mit der tatsächlichen verglichen und diskutiert werden und so geht’s ein rollenspiel hat meist drei phasen vorbereitung durch führung, auswertung. in der vorbereitung müssen das ziel des spiels, rollen und situationen geklärt werden. für ein möglichst realitätsnahes spiel müssen zuerst entsprechende informationen erarbeitet werden. dabei können rollenkarten für die spieler angefertigt werden auf denen steht, wie sie sich zu verhalten oder zu reden haben. genauso wichtig ist eine sorgfältige auswertung des spiels dabei beurteilen spieler und zuschauer die überzeugungskraft der rollengestaltung und diskutieren ob das historische geschehen wohl so abgelaufen sein könnte und ihnen das spiel eine genauere vorstellung davon verschafft hat arbeitsschritte 1. vorbereitung 2. durchführung 3. auswertung klärt ziel und inhalt (rollen szene) des spiels: betrachtet dabei die historische situation verteilt die rollen: wer spielt was? welche aufgabe hat die klasse erarbeitet das rollenverhalten z. b. in gruppenarbeit). berücksichtigt dabei vor allem, wie viel freiraum die rollenspieler für ihr spiel haben sollen fertigt ggf. rollenkarten an spielt die rollen gemäß der rollenverteilung und dem zuvor festgelegten rollenverhalten versetzt euch dabei in die damalige zeit ggf. kann die klasse aktiv (fragt nach, kommentiert) in das spielgeschehen einbezogen werden spieler: berichtet, wie ihr die eigene rolle erlebt habt mitspieler und klasse: äußert euch zur rollengestaltung der spieler beurteilt gemeinsam die realitäts nähe und überzeugungskraft des spiels beim spiel von ent schei dungssituationen: vergleicht und diskutiert die entscheidung im spiel mit der historischen realität diskutiert weiterführende fragen, die sich aus dem spiel ergeben ein rollenspiel entwickeln band 5/6 seite 92/93 arbeitsschritte
auf einen blick mit einem gruppenpuzzle lernen band seite 24/25 arbeitsschritte kompetenztraining gemeinsam lernen gruppenpuzzle wie lebten die menschen in der mittelalterlichen ständegesellschaft 1. phase: arbeit in stammgruppen teilt zuerst die klasse in stammgruppen mit jeweils sechs mitgliedern ein. wiederholt, was ihr unter der mittel alterlichen ständegesellschaft versteht lest dazu den verfasser text auf den seiten 20/21 und stellt die ergebnisse den abbildungen q1 und q6 s. 23) gegenüber. einigt euch dann, wer die folgenden teilthemen als experte oder expertin genauer untersucht 2. phase: arbeit in expertengruppen gruppe a: das leben der adligen die stellung des adels in der gesellschaft die rechte und pfl ichten der adligen die burg als zentrum der herrschaft material vt s. 26/27, z. 1–87; s. 27 q1 ; s. 29 q7 gruppe b: die welt der ritter wie man zum ritter wurde was von einem ritter erwartet wurde wie die ritter lebten material vt s. 27, z. 89–118; s. 28/29 q2 q6 gruppe c: das leben der geistlichen unterschiedliche gruppen von geistlichen und ihre aufgaben die herkunft der mönche und nonnen leben und arbeit im kloster material vt s. 30/31, z. 1–87; s. 30 q1 ; s. 32/33 d1 q3 q4 arbeitsschritte 1. phase: arbeit in stammgruppen 2. phase: arbeit in expertengruppen 3. phase: arbeit in stammgruppen einigt euch, wer welches teilthema bearbeiten möchte lies dir deine aufgabe genau durch untersuche das material ent sprechend der aufgabe halte deine ergebnisse in form von notizen fest beachte die zeitvorgabe deiner lehrerin bzw. deines lehrers stellt euch als experten zum gleichen thema gegenseitig eure arbeitsergebnisse aus der ersten arbeitsphase vor fertigt dazu notizen an ergänzt und korrigiert euch gegenseitig verständigt euch auf ein gemeinsames ergebnis stellt euch als experten zu unterschiedlichen themen gegen seitig eure arbeitsergebnisse aus der zweiten arbeitsphase vor diskutiert die arbeitsergebnisse und klärt offene fragen einigt euch, wie ihr der klasse eure ergebnisse vorstellen wollt bereitet die präsentation vor präsentiert die arbeitsergebnisse und wertet sie anschließend aus gruppe d: neue orden – neue klöster die notwendigkeit für reformen klöster als zentrum von kultur und bildung material vt s. 31, z. 89–141; s. 31 q2 ; s. 33 q5 gruppe e: das leben in den dörfern anlage und aussehen der dörfer leben und arbeit der bauern in abhängigkeit von der natur die verwaltung der dörfer material vt s. 34/35, z. 1–94; s. 34 d1 ; s. 36 q1 gruppe f: veränderungen in der landwirtschaft die dreifelderwirtschaft technische neuerungen und erfi ndungen veränderungen der natürlichen bedingungen folgen der veränderungen material vt s. 35, z. 96–117; s. 35–37 d2 q2 q5 3. phase: arbeit in stammgruppen jede stammgruppe erarbeitet eine präsentation zum leben der menschen in der mittelalterlichen stände gesellschaft und stellt sie in der klasse vor diskutiert eure arbeitsergebnisse. beurteilt zum schluss das leben der menschen in der mittelalterlichen grundherrschaft und in der ständegesellschaft. beachtet dabei, wie die menschen damals dachten und wie ihr heute darüber denkt
begriffsglossar adel führender stand in der mittelalterlichen gesellschaft der seine macht auf grund- und herrschaftsbesitz, die nähe zum könig und erlangte vorrechte (privilegien) stützte. adlige herrschten über abhängige. sie verfügten über ein großes ansehen, das sie aus ihrem besitz, ihrer vornehmen abstammung und den geleisteten diensten für das reich zogen. (s. 26 agrargesellschaft die mittelalterliche gesellschaft wird als agrar gesellschaft bezeichnet, weil die große mehrheit der bevölkerung (90 prozent) auf dem lande in und von der landwirtschaft lebte. (s. 34 allgemeines wahlrecht wahlrecht aufklärung die aufklärung bezeichnet ein denken im 18. jahrhundert, das alle menschen auffordert, ihre vernunft zu gebrauchen und danach alle bereiche des lebens zu ordnen. sie kritisierte die religion und die auf ihr gründende ordnung von staat und gesellschaft. (s. 158 aztekenreich das volk der azteken hatte im 14. und 15. jahrhundert auf dem gebiet des heutigen mexiko ein mächtiges reich errichtet. spanische konquistadoren zerstörten das aztekenreich im 16. jahrhundert. (s 105/106 bankwesen im 14. jahrhundert entstanden in den städten ober italiens banken mit filialen in ganz europa. wie heutige banken tauschten sie geld um, nahmen überweisungen vor, gaben kredite und stellten wechsel aus. (s. 90 bauern über 90 prozent der menschen in der mittelalterlichen gesellschaft lebten und arbeiteten als bauern auf dem land. es gab freie und unfreie bauern. die bauern gehörten zum dritten stand. (s. 34–37 bauernkrieg als bauernkrieg bezeichnet man die bauernaufstände von 1524 bis 1526 in deutschland, in denen die bauern ihre freiheit von frondiensten und abgaben erkämpfen wollten. (s. 120–123 buchdruck johannes gutenberg erfand den druck von büchern mithilfe von beweglichen lettern aus metall, die immer neu zusammengesetzt werden konnten. (s. 82 bürger ein bürger schwor seiner stadt mit dem bürgereid treue und gehorsam. bei rechtsstreitigkeiten konnte er städtische gerichte anrufen oder den rat um hilfe bitten. (s. 46 burg befestigter, möglichst gut zu verteidigender wohnsitz von adligen im mittelalter. neben dem burgherren samt seiner familie lebten zahlreiche bedienstete auf einer burg. in kriegszeiten suchten auch die bauern aus der umgebung den schutz der burg. (s. 26/27 dorf in einem mittelalterlichen dorf siedelten mehrere bauern familien zusammen, die ihre arbeit und ihren alltag gemeinsam organisierten und sich als gemeinde oft selbst verwalteten. (s. 34–35 dreieckshandel austausch von rohstoffen fertigwaren und sklaven zwischen amerika, europa und afrika (s. 106, 109 fernhandel seit dem späten mittelalter brachen kaufleute auf, um luxusgüter aus fernen ländern nach europa zu bringen. so entstanden handelsverbindungen über die ostsee die gewürzund die seidenstraße und später über den atlantik nach amerika. (s. 90 freiheit grundprinzip der aufklärung und der französischen revolution. die erklärung der menschen- und bürgerrechte sah die menschen als frei geboren an und leitete daraus persönliche und politische freiheitsrechte wie die meinungs- oder religionsfreiheit ab s. 173 frömmigkeit ausrichtung des lebens nach den regeln der religion (s. 12, 30/31 gleichheit grundprinzip der aufklärung und der französischen revolution. die erklärung der menschen- und bürgerrechte sah die menschen als von geburt gleich an. sie sollten deshalb auch vor dem gesetz gleich sein und gleiche politische rechte ( allgemeines wahlrecht) erhalten. während der revolution kam außerdem die forderung nach sozialer gleichheit (besitz und einkommen) auf s. 173 begriffsglossar du findest in der randspalte deines schülerbuches begriffserklärungen. wichtige fachbegriffe, wie zum beispiel dreiecks handel oder adel kannst du hier im glossar noch einmal auf einen blick nachschlagen. zum besseren verständnis der verfassertexte sind zudem begriffe wie kredit und zinsen ebenfalls in der randspalte erklärt im folgenden glossar sind verweise auf einen anderen begriff mit gekennzeichnet
auf einen blick grundherrschaft organisationsform der herrschaft auf dem lande im mittelalter. die bauern mussten an ihre herren abgaben zahlen und frondienste leisten. formen der grundherrschaft bestanden in vielen ländern europas bis ins 19. jahrhundert. (s. 20–23 heiliger krieg krieg zur verteidigung oder zur ausbreitung einer religion (s. 69 ideentransfer die weltweite verbreitung und aufnahme von ideen. beispiel sind die menschenrechte und die demokratie, die durch die aufklärung verbreitet und erstmals in der amerikanischen, dann in der französischen revolution und schließlich in weiteren bürgerlichen revolutionen umgesetzt wurden. (s. 191 imperium von lat. imperare = herrschen) man bezeichnet damit ein reich das große teile der welt beherrscht. imperien haben dabei einen bedeutenden einfluss auf die geschicht liche entwicklung neben dem römischen reich (imperium romanum) in europa zählen außerhalb europas das chinesische und das mongolische reich zu den wichtigsten imperien der geschichte individuum im zeitalter der renaissance und des humanismus rückte der einzelne mensch mit seinen fähigkeiten und kräften in den mittelpunkt des denkens. er wurde als freie und schöpferische persönlichkeit gesehen. (s. 78/79 juden im frühen mittelalter siedelten sich jüdische händler in vielen europäischen städten an. es entstanden jüdische gemeinden mit eigenen synagogen, schulen und geschäften. sie standen unter dem schutz der bischöfe und des kaisers schutzprivileg . (s. 58 kirche mittelalter kirche, glaube und religion spielten im mittelalter eine zentrale rolle im leben der menschen. die regeln der kirche, die ein von frömmigkeit geprägtes leben einforderten, galten den menschen als richtschnur. (s. 14 klerus lat. = priesterstand) der geistliche stand weihte sein leben gott um dessen wort zu verbreiten und seelsorge zu betreiben die geistlichen unterschieden sich aufgrund ihrer herkunft und ihrer stellung stark vonein ander. (s. 30 kloster von lat claustrum abgeschlossener raum anlage aus kirche wohn- und wirtschaftsgebäuden, in der mönche oder nonnen nach festen regeln des glaubens lebten. (s. 30/31 klosterschule im mittelalter waren die klöster lange die einzigen einrichtungen die kindern unterricht im lesen, schreiben und rechnen, später in latein den wissenschaften und schließlich der religionslehre gaben. (s. 31 könig/königtum in europa bildete sich im mittelalter ein königtum aus, in dem der könig als oberster lehensherr zusammen mit seinen (kron-)vasallen regierte. er war auf ihre dienste im krieg und ihren rat in friedenszeiten angewiesen und sicherte ihnen dafür seinen schutz zu s. 12/13, 14–17 kolonialisierung im 16. jahrhundert einsetzender prozess der weltweiten ausdehnung europäischer macht. europäische staaten eroberten gebiete auf anderen kontinenten und errichteten dort koloniale herrschaften. (s. 104–109 konfessionalisierung zeitabschnitt im anschluss an die reformation als sich die landesherren auf ein glaubensbekenntnis z. b römisch-katholisch evangelisch-lutherisch evangelischreformiert für ihren territorialstaat festlegten 124/ konstitutionelle monarchie staatsform mit einem monarchen an der spitze, der aber an eine verfassung gebunden ist. (s. 178 kopernikanische wende übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen weltbild. nikolaus kopernikus hat sie durch seine ent deckung, dass die erde wie andere planeten die sonne umkreist, eingeleitet. (s. 86 kreuzzug der vom papst verkündete heilige krieg“ der christen zur verteidigung und ausbreitung der christlichen herrschaft er wurde im mittelalter gegen muslime, heidnische slawen und christliche ketzer geführt. (s. 69 kulturtransfer osmanisches reich lehen/lehensvergabe vasallen (= lehensmänner) bekamen vom lehensherrn land und/ oder ämter (= lehen) verliehen. die vasallen waren gegenüber dem lehensherrn zu hilfe und rat verpflichtet. die lehensmänner des königs hießen kronvasallen, die lehensmänner der kronvasallen untervasallen. (s. 14–17 lesegesellschaft gebildete trafen sich in den salons vornehmer damen, um gemeinsam die schriften der aufklärer zu lesen und zu diskutieren. (s. 159 luxuswaren bezeichnung für die während der zeit der kolonialisierung in europa begehrten handelsgüter, wie gewürze, tabak, kaffee, zucker oder baumwolle. (s. 106
begriffsglossar markt ursprünglich versteht man darunter den ort, an dem waren angeboten und verkauft werden. namen wie „ alter markt“ oder „salzmarkt“ erinnern noch heute daran. (s. 43 menschenund bürgerrechte die aufklärung ging davon aus dass alle menschen frei und gleich geboren werden und unveräußerliche rechte haben erstmals wurden diese rechte in der amerikanischen verfassung (1787 und den bill of rights 1789 festgeschrieben daran orientierte sich die erklärung der menschen- und bürgerrechte in der französischen revolution august 1789 die die glaubensund meinungs freiheit sowie die gleichheit vor dem gesetz proklamierte. (s. 173 mongolensturm als mongolensturm bezeichnet man die überfallartigen eroberungen der mongolen in asien und europa. in den jahren 1241/42 erreichten die mongolen das heutige polen und österreich. erst der tod ihres khan führte zum rückzug der mongolen in europa. (s. 65 nation als merkmale einer nation gelten gemeinsame abstammung, sprache, kultur und geschichte sowie das zusammen gehörigkeitsgefühl der menschen, die in einem gebiet zusammenleben. (s. 172 osmanisches reich die türkischen osmanen herrschten über ein riesiges reich und eroberten bis ins 17. jahrhundert große teile des balkan. sie versperrten den europäern damit die handels wege nach indien und china und veranlassten sie, einen seeweg nach indien zu finden. ihr vorrücken löste in europa eine welle der türkenfurcht aus. gleichzeitig entstand durch das zusammenleben von muslimen und christen ein kultureller austausch oder kultur transfer . (s. 100–103 pax mongolica lat für mongolischer friede innerhalb des mongolen reiches herrschten außergewöhnlich geordnete und fried liche zustände. (s pax universalis lat. = allgemeiner frieden bezeichnung für den anspruch des westfälischen friedens, nach 30 jahren krieg zwischen unterschiedlichsten kriegsgegnern einen frieden für alle zu schaffen. erstmals traten die den frieden verhandelnden staaten dabei als gleichberechtigte partner auf und schufen damit ein modell, das jahrhundertelang als vorbild galt. (s. 131 pest auch schwarzer tod die pest ist eine seuche, die sich im 14. jahrhundert über die seidenstraße bis nach europa verbreitete. der erreger stammte aus asien und wurde von ratten auf flöhe und menschen übertragen. (s. 65 reformation lat. = umgestaltung, erneuerung) religiöse erneuerungsbewegung des 16. jahrhunderts, die zur entstehung der evangelischen kirche führte. (s. 116/117 reich/heiliges römisches reich so wird etwa ab dem 13. jahrhundert der herrschafts bereich der römisch-deutschen könige und kaiser bezeichnet. neben dem heutigen deutschland gehörten unter anderem norditalien, burgund und einige mittel europäische gebiete dazu. (s. 14, 134 renaissance franz. für wiedergeburt) bezeichnung für eine geistige bewegung die vom ende des 14. bis zum ende des 16. jahrhunderts dauerte und sich ausgehend von italien über ganz europa verbreitete. (s. 78 republik bei dieser staatsform wird das volk als höchste gewalt angesehen regierung und parlament werden nur auf zeit gewählt. (s. 178 revolution eine revolution ist eine schnelle grundlegende oft gewaltsame veränderung der gesellschaft der herrschaftsstruktur und der wirtschaft. sie vollzieht sich meist unter beteiligung breiter teile der bevölkerung. (s. 172 rittertum die bezeichnung ritter leitet sich vom wort „reiter“ ab. ritter waren schwer bewaffnete und gepanzerte reiterkrieger, die im laufe des mittelalters zu einer eigenen schicht des adels aufstiegen. schutz von schwachen, treue zu gott und ein faires verhalten im kampf gehörten bald zu ihren idealen. (s. 26–29 schreckensherrschaft herrschaft der radikalen jakobiner unter ihrem anführer robbespierre während der französischen revolution. er regierte durch schrecken (frz. terreur): vermeintliche gegner der revolution wurden auf bloßen verdacht hin verfolgt und hingerichtet. (s. 179 schutzprivileg juden seeweg nach indien osmanisches reich seide seide war ein kostbarer stoff, mit dem weltliche und geistliche herrscher im mittelalter ihre macht und ihren reichtum zeigten. die wertvollen waren wurden über tausende kilometer auf land- und seewegen gehandelt. (s. 65 seidenstraße die seidenstraße war ein netz von karawanenstraßen die das mittelmeer auf dem landweg mit ostasien verbanden über sie wurden bis ins mittelalter viele waren ausgetauscht, z. b. seide aus china. aber auch krank heiten wie die pest breiteten sich über diesen handelsweg aus. (s. 65 selbstverwaltung bezeichnung für die übernahme von verwaltungsaufgaben in der mittelalterlichen stadt durch stadträte (s. 46
auf einen blick sonnenkönig könig ludwig xiv. von frankreich sah sich selbst als absoluter herrscher, der wie eine sonne alles überrage und alles gute für das land hervorbringe. (s. 140/141 stadtluft macht frei die redensart aus dem mittelalter weist darauf hin, dass die menschen in der stadt mehr freiheiten hatten als auf dem land. unfreie die in die stadt zogen, konnten nach etwa einem jahr ihre freiheit bekommen. (s. 46 stadtrat/rat stadtherr war ursprünglich der könig, später auch bischöfe, herzöge oder grafen. seit dem 13. jahrhundert erstritten die bürger die einrichtung eines stadtrates und wählten aus ihren reihen einen bürgermeister. der stadtrat erließ z. b. anordnungen über die höhe der steuern. (s. 46 stand/stände gesellschaftliche gruppen mit gemeinsamen kenn zeichen, z. b. herkunft der geburt, beruf, bildung. im mittel alter unter schied man drei stände: den ersten stand bildeten die geistlichen (der klerus weil sie für das heil der menschen beteten. der zweite stand waren die adligen vom herzog bis zum ritter, die über land und menschen herrschten und ihnen dafür schutz boten. die meisten menschen waren abhängige bauern mit wenig rechten; sie gehörten zum dritten stand. (s. 21 ständegesellschaft vor der französischen revolution war die gesellschaft nach geburt in klerus, adel und bürgertum eingeteilt. (s. 147 territorialstaat selbstständiger, von einem fürsten regierter staat mit eigener gesetzgebung, rechtsprechung und steuerhoheit (s. 134 treueid gegenseitiger schwur zwischen lehensherr und vasall. der lehensherr versprach dem vasallen schutz, dieser wiederum gelobte seinem lehensherren gehorsam, rat und hilfe. (s. 14–17 unabhängigkeitserklärung amerikanische nach langen auseinandersetzungen erklärten die britischen kolonien in nordamerika am 4. juli 1776 ihre unabhängigkeit von großbritannien. das war der höhepunkt der amerikanischen revolution, die schließlich den staat usa mit einer eigenen demokratischen verfassung (1787) hervorbrachte. (s. 190–193 verfassung in einer verfassung ist die grundordnung eines staates meist schriftlich niedergelegt. sie legt fest, welche politischen institutionen es gibt und welche rechte diese haben, sie regelt das wahlrecht und enthält häufig die grundrechte der bürger und bürgerinnen. (s. 172 wahlrecht die französische verfassung von 1791 garantierte allen männern ab 25 jahren ein allgemeines und gleiches wahlrecht. allerdings wurde es durch einen zensus beschränkt: nur wer eine mindeststeuer von 4 mill. livres zahlte, durfte wählen. ab 1793 galt das allgemeine (männer-) wahlrecht ab 21 jahren ohne zensus. in deutschland kämpften arbeiter und bürger in der revolution von 1848 für das allgemeine wahlrecht. (s. 182 zensuswahlrecht wahlrecht zunft/zunftzwang zusammenschluss der meister eines handwerks. in vielen städten mussten alle meister eines handwerks der zunft angehören. ihre höchstzahl war begrenzt. häufig durften auch keine ortsfremden eine werkstatt eröffnen und nur die kinder aus handwerkerfamilien das handwerk er lernen. (s. 50
begriffsglossar 4. juli 1776 tag d. amerik. 1 unabhängigkeitserklärung) 164, 191 a aachener kaiserpfalz 16 f aachener pfalz 12, 13 (a abendmahl 80 (a), 127 abgaben 20–22, 31, 34, 39 (a), 120–122, 147 ü), 149, 152 f., 166–168, 170 f , 188 ablass(briefe , 117, 125 absolutismus 140 , 142–166 abt/äbtissin 30, 32 (a), 47, 140 acht 112 ackerbau 37 (a adel/adlige 15, 17, 20 , 27, 31, 81, 105 123, 130, 140 f., 146, 147 (ü), 153, 156, 166 f 170–173, 179 afrika 78, 104–106 agrargesellschaft 34 ägypten 90, 188 akkon (letzte kreuzfahrerstadt) 70 aktivbürger 182 (ü alembert, jean le rond d’ (1717–1783), frz aufklärer 158 alexander vi. (1492–1503), papst 136 (a allgemeines wahlrecht 1 wahlrecht allmende 34 amar, jean-baptiste-andré (1755–1816), frz revolutionär 180 amerika 53, 76 f., 105 f.; 1 usa amerikanische revolution 190–193 amtsadel, frz. 140 , 147 anatomie 86, 89 (a antike 12, 18, 31, 33, 62, 76, 78 f., 83, 101 arbeiter 90, 147 (ü), 166 f., 169 (ü), 178 aristoteles (384–322 v. chr.), griech. philosoph u. naturforscher 86 (a), 87 asien 65, 82, 101, 104, 106 assemblies (volksvertreter) 190 assignaten (papiergeld d. 1 französischen revolution) 179 atahualpa (um 1500–1533), letzter herrscher des 1 inkareiches 109 aufklärer/aufklärung 158–161, 190 f auge der vorsehung (symbol d. 1 französischen revolution) 173 (a augsburger religionsfrieden (1555) 112 128–131, 134 azteken(reich) 77, 105–109, 111 b babel (turmbau) 57 (a baden 121, 134 (k), 144, 156 baden-württemberg 136, 156 f ballhausschwur (1789) 172 (a bankwesen/bankhäuser 76, 90 f., 93 (a bankier 90 bankrott barock 144, 156 f bastille/sturm auf die ~ (1789 beginn d 1 französischen revolution) 164 (a), 173 (a bauern (dritter stand) 10, 20 f., 22 (a), 23 34–38, 39 (a), 40–42, 69, 105, 120–122, 123 a), 146, 147 (ü), 152 f., 166 f., 169–173 bauernkrieg/bauernaufstände (1524/25 112, 120, 121 (k beamte 54, 105, 126, 130, 134, 141, 147, 182 f beginen , 63 (a benediktinerorden 10, 31 bergwerke 90, 91 (k), 106 beschwerdehefte (cahiers de doléances , 168 f bibel 18 f., 30 f., 57 (a), 69, 79, 82 f., 85–88 117, 125, 142 bildhauer(ei) 78 f bildung/bildungswesen 12, 31, 105, 125, 159 161, 177 bill of rights (1791) 191, 193 bischof 15, 17, 19 f., 30, 46, 56–58, 59 (a), 69 122, 125, 129, 140, 147, 156 bistum 33, 129, 134 böhmen 130, 134 bossuet, jacques-bénigne (1627–1704), frz theologe u. bischof 142 boston tea party (1773) 190 brandenburg/brandenburg-preußen 124 134, 147 bruno, giordano (1548–1600), ital. mönch bruyn der ältere, bartholomäus 1493–1555), dt. renaissancemaler 81 bry, theodor de (1528–1598), dt. kupferstecher u. 1 verleger 106 buchdruck 76, 82, 83 (a), 84 f., 95, 100, 117 buchmalerei, mittelalterl. 18 (a), 19, 23 (a 28 (a), 30 (a), 31 (a), 36 (a), 37 (a), 60 (a 63 (a buddhisten 64, 67 bundesverfassung (usa 1787) 164, 191, 193 burg hohenzollern (baden-württemberg 27 (a burgen(bau) 10 f., 20, 26, 27 (a), 121 bürger/bürgerrecht , 78 byzantinisches reich 69, 76, 100 c calvin, johannes (1509–1564), frz. theologe u. schweizer reformator 112, 125, 127 calvinismus , 127 (a), 131 chávez, hugo (1954–2013), venezol. staats präsident 111 china 64, 82, 84, 104 chlodwig i. (466–511), fränk. könig 481–511) 12 chodowiecki, daniel (1726–1801), poln maler 161 christen(tum) 14, 23, 31, 33, 58–60, 62, 64 67–73, 78–81, 86, 88 f., 94–100, 106, 112–137 christian iv. (1577–1648), könig v. dänemark u. norwegen (1588–1648) 130 christianisierung 12 christus 58, 68 f., 80, 81 (a clemens august von bayern (1723–1761 erzbischof u. kurfürst von köln 163 (a code civil (bürgerliches gesetzbuch 1804 colbert, jean-baptiste (1619–1683), frz staatsmann u. wirtschaftspolitiker 143 152–155 a = abbildung; amerik. = amerikanisch dt. = deutsch; engl. = englisch; europ. = europäisch; evang. = evangelisch; fläm. = flämisch; fränk. = fränkisch; frz. = französisch; griech. = griechisch; hrr = heiliges römisches reich; ital. = italienisch; jh = jahr hundert; jüd. = jüdisch; k = karte mechan. = mechanisch; mittelalterl = mittel alterlich; mongol. = mongolisch; niederl. = niederländisch; norm. = normannisch; patriot. = patriotisch; preuß = preußisch; port. = portugiesisch; röm = römisch; sächs. = sächsisch; schott. = schottisch; schweiz. = schweizerisch; span = spanisch ü = übersicht/schaubild; venezol. = venezolanisch; wiss. = wissenschaftlich hinweise verweis auf ein stichwort ersetzt das stichwort bei wieder holung bei fachbegriffen, die im buch erläutert werden, ist die entsprechende seitenzahl halbfett gesetzt. hinter den personennamen sind die lebens daten gesetzt, bei amtsträgern ist die jeweilige amtszeit ergänzt register ausgewählter personen und begriffe
auf einen blick cortés, hérnan (1485–1547), span. eroberer 77, 105 f., 108, 111 couder, auguste (1789–1873), frz. maler 168 d dänemark 130 david, jacques-louis (1748–1825), frz. maler 172, 189 desmarées, george (1697–1776), schwed maler 163 despotismus der freiheit (1 robespierre 181, 184 deutsche hanse 53 díaz, bernal (1492–1584), span. hauptmann diderot, denis (1713–1784), frz. philosoph u schriftsteller 158, 160 digitale revolution 83, 85 (a direktorium doppelte buchführung 91 f dorf(gemeinschaft) 20, 34 (a), 35 dorfschulze (bauernmeister/schultheiß) 35 dreieckshandel , 109 (a dreifelderwirtschaft 11, 35 (a dreißigjähriger krieg 113, 130, 131 (k), 132 a), 133 (a), 134 dritter stand 1 bauern dschingis khan (um 1160 – um 1227), mongolenherrscher u. großkhan (1206–1227 e eberhard ludwig, herzog von württemberg (1676–1733) 138, 144 f., 156 f elsass/elsass-lothringen 146 empirismus , 87 encyclopédie england/großbritannien 28, 130, 141, 154 166, 176, 190–193 entdeckungsreisen, europ. 77 (k epochenwandel 79 erklärung der menschen- und bürgerrechte (frankreich 1789) 164, 173, 174 (a 175 f., 183, 191 erklärung der rechte der frau und bürgerin (1791 1 olympes de gouges) 173 erklärung der rechte des kindes/kinderrechtskonvention (uno 1959/1989) 176 f eroberer, span. 1 konquistador eroberungskriege (1 napoleon) 165 erster konsul 165, 188 erster stand 1 adel/adlige evangelisch exekutive 182 (ü), 193 (ü expansion, europ. 1 kolonien f fabrik(wesen) 152 farris, joseph (1924–2015), us-amerik. cartoonist 85 fasnet/fasnetshexe 98 f fegefeuer 116, 118 fehde ferdinand ii. (1578–1637), kaiser d. hrr 1619–1637) 129 f ferdinand iii. (1808–1657), kaiser d. hrr 1637–1657) 132 (a ferner osten 78, 104 fernhandel/fernhändler 52 f., 58, 90 fernrohr 87, 88 (a), 159 feudalismus filiale (niederlassung bank) 90 florenz 88, 90, 105 flugblatt , 117 folter 94–97 forschung, wiss. 158 (a), 161 frankenreich 12, 14 (k), 15 franklin, benjamin (1706–1790), us-ame rik staatsmann 191 frankreich 14, 28, 73, 93, 130 f., 138, 139 (k 140–143, 146–162, 164–176, 178–191 franz von assisi (1181/82–1226), begründer des 1 franziskanerordens 31 franziskanerorden 11, 31 französische revolution 95, 164, 165 (k 172–175, 178–190 frauen(rechte) 62 (a), 63 (a), 180 frauenklubs, patriot. 179, 180 (a freiburg im breisgau 40, 44, 45 (a), 47 (a freie 20 f freiheit, gleichheit, brüderlichkeit ( losung d. 1 französischen revolution) 164, 172 f 178 f., 184 f french and indian war (1756–1753) 190 frieden von paris (1783) 191 friedrich i. barbarossa (um 1122–1199), kaiser d. hrr (1155–1190) 11, 29 friedrich ii. der große (1712–1786), preuß könig (1740–1786) 141 friedrich iii./friedrich der weise (1463– 1525), kurfürst von sachsen (1486–1525 frömmigkeit frondienste 20 (a), 22 fronhof (meierhof) 20 (a), 21 f., 34 frühe neuzeit 12 , 103 (k fugger (bank- und handelsgesellschaft 90, 91 (k), 92 f fugger, jakob (1459–1525), dt. handelsherr u. fernhändler 90, 92 (a fürsten 14–17, 33, 69, 81, 92, 100, 109, 116 f 119, 121 f., 125–132, 134, 142, 144, 156, 181 g galen/galenos von pergamon (ca 129–um 200), röm. arzt u. anatom 86 galilei, galileo (1564–1642), ital. mathematiker u. astronom 86–88, 159 gama, vasco da (um 1469–1524), port. seefahrer 101, 103, 105 gegenreformation geistliche 15, 19–21, 27, 30–33, 81, 116, 129 geldverleih 58 f geldwechsler 90 generalstände , 168 (a), 172 genf 112, 125 genua 70, 101, 104 geoffrin, marie-thérèse (1699–1777), frz salonière 159 geozentrisches weltbild 86, 87 (a gesetz über die verdächtigen (1793) 185 getto (jüd. wohnviertel) 59 gewaltenteilung 139 , 191, 193 (ü gewürze/gewürzhandel 70, 101, 102 (ü 103 f., 106 gillray, james (1757–1815), brit. karikaturist u. radierer 186 glaubenskonflikte 112–137 glaubenswelt, spätmittelalterl. 116 f., 118 goldene bulle (1356) 11 , 15 gotik (baustil) 40, 45, 47, 56 (a gottesgnadentum 14 gouges, olympes de (1748–1793), frz. frauenrechtlerin 173 grafen 15 f., 46 großbritannien 1 england grundgesetz der bundesrepublik deutschland 176 grundherr 20 f., 29 (a), 34, 46, 112, 120 f 153, 173 grundherrschaft, mittelalterl. 10 21–23 grundrechte 172, 176 f guillaume le maréchal/william marshal 1144–1219), anglo-norm. ritter 28 guillotine (fallbeil) 178 (a), 185, 186 (a guldenmund, hans (um 1500–1560), dt buchdrucker 102 gustav ii. adolf (1594–1632), könig v schweden (1611–1632) 131, 132 (a gutenberg, johannes (1397/1400–1468 erfinder d. 1 buchdrucks m. beweglichen lettern 82 f h habsburger 90, 92 haiti (hispaniola) 104 hamburg 53 (a handel/händler 42 f., 52–55, 59, 70, 78, 82 90 f., 104 f., 153–155, 166–168 handelsgesellschaften (gründungen) 76 handelsrouten (frühe neuzeit) 103 (k handelswege (um 1400) 52 (k
register handgang 16 (a handwerk/handwerker 41, 43, 50, 51 (a 58, 62, 64 f., 178 hanse(städte) 41, 52 (k), 53–55 harvey, william (1578–1657), engl. arzt u anatom 86 hausmacht 14 heiliger krieg , 70 heiliges land , 70 heiliges römisches reich , 129 (k), 134 135 (k heinrich iv. (1553–1610), frz. könig (1589– 1610) 147 heinrich vii. (1457–1509), könig v. england 1485–1509) 60 (a heliozentrisches weltbild 77, 86, 87 (a herrenhof 20 (a), 21, 26 herzöge 14–17, 26, 46, 144 hexen(verfolgung)/hexerei 12, 94, 95 (a 96 (a), 97 (a), 98, 99 (a hexensabbat 94, 95 (a hexenverbrennung 95, 96 (a hohenzollern 134 (k holland 1 niederlande hopfer, hieronymus (um 1500–nach 1550 dt. kupferstecher u. radierer 116 horber ritterspiele 10 (a), 11 houel, jean-pierre (1735–1813), frz. maler hufe (bäuerlicher hof) 20 hugenotten(verfolgung) 138, 147, 148 (a humanismus humanist 78 f hungersnot 36, 95 i ideentransfer 191 imperium 64 indianer/indios (ureinwohner amerikas 104, 107 indien 101, 103 (k), 104 f indigene völker 77 (k , 106 inka(reich) 77, 105 f., 109 inquisition 87 f insignien 15; reichs~ 15 (a islam 69 f., 73, 100 istanbul (früher: 1 konstantinopel) 100 italien 14, 31, 50, 70, 78 f., 90, 101, 188 j jakobiner 165, 178 , 181, 183 f., 188 jakobinerherrschaft 1 schreckens herrschaft janitscharen , 102 japan 104 jefferson, thomas (1743–1826), präsident der usa (1801–1809) 191 f jerusalem 68 (a), 69–71, 72 (a jesuiten(orden) 97 ; ~kirche 137 (a jesus christus (von nazareth) 1 christus juden(tum) 21, 40, 58, 59 (a), 60 (a), 61 (a 68 f judikative 182 (ü), 183, 193 (ü k kalm, pehr (1716–1779), schwed. naturforscher 192 kant, immanuel (1724–1804), dt. philosoph 158, 160 karl iii. wilhelm von baden-durlach (1679– 1738), markgraf 156 (a karl der große (747–814), fränk. könig 768–814) u. röm. kaiser (800–814) 10, 12–14 26 f karl v. (1500–1558), kaiser d. hrr 1519–1556) 92 f., 117, 119 karlsruhe 156 (a karolinger 14 katholiken 112, 113 (k), 124 f., 129 (k 130–132 katholisch ; 1 katholiken katholische liga (1609) 113, 128 (a), 130 katholische reform katholizismus/katholische kirche 146–149, 185 kaufleute/kaufmann 44, 52–55, 70, 75 (a 78, 90–93, 105 kaufmannshaus 54 (a kepler, johannes (1571–1630), dt. astronom u. mathematiker 87 ketzer 69, 89 , 117 khan (herrscher) 64–67 khanate 65 kinderarbeit 176 (a), 177 kinderlese 100 kinderrechtsorganisationen 176 f kirchenbann 117 kirchenordnungen 125 kirchenspaltung 95, 112–137 kleine eiszeit 95 klerus , 81, 141, 146, 147 (ü), 153, 166 f 170–173 klimaveränderung 1 kleine eiszeit kloster(leben) 20, 30 f., 32 (a), 33, 38, 156 173; ~orden 31, 82, 121, 123 (a); ~schule 31 knappe 27 kogge (einmastiges segelschiff) 55 (a köln 44, 47 (a), 50, 53, 62 f kolonialherrschaft , 106 kolonialisierung (europäisierung) 104–109 kolonie 77, 105 (k ; ~, engl. 164, 190, 191 k), 192 f kolumbus, christoph (1451–1506), ital. seefahrer u. entdecker 1 amerikas (1492) 76 f 104 f., 106 (a), 107, 111 konfession 113 (k , 128, 129 (k konfessionalisierung 125 kongress, us-amerik. 193 (ü könig/königtum 12–17 königswahl 1 goldene bulle konquistador , 106 konrad i. von zähringen (um 1090–1152 herzog 40, 44 konstantin i. (um 285–337), röm. kaiser 306–337) 68 konstantinopel 69, 71, 76, 100 f., 104, 108 konstitutionelle monarchie , 183 kontinentalkongress kontor (handelsniederlassung) 53 konzil von clermont (1095) 69 konzil von trient (1545–1563) 112, 125 kopernikanische wende 86 f., 89 kopernikus, nikolaus (1473–1543), jurist arzt u. astronom 77, 86 (a), 87 f koran kredit kreuzfahrer 69–71, 72 (a), 73, 90 kreuzzug 40, 59 k), 70 (a), 71, 72 (a), 73 75 (a kronvasallen 15; 1 vasall kuba 104 kublai khan (1215–1294), mongolenherrscher (1260–1294) 64 kulturtransfer 101 kurfürsten 1 fürsten l laien(prediger) 30 landesherren 43, 53, 59, 121 , 134, 144 156 f landnutzung (900–1300) 41 (k landshut 44 landwirtschaft 41 (k), 34, 35 (a), 36 (a), 37 a), 79, 105, 153, 159 las casas, bartolomé de (1474–1566), span bischof u. missionar 107 le barbier, jean-jaques françois 1738–1826), frz. maler 174 legislative 182 (ü), 193 (ü lehen/lehensvergabe 14 , 16 (a), 27 lehenseid 16 (a lehensherr 15 f leibeigenschaft , 173 lemonnier, gabriel (1743–1824), frz. maler leonardo da vinci (1452–1519), ital. universalgelehrter 76, 79 f lesegesellschaft 159 (a lichtenberger, johannes (um 1426–1503 dt. astrologe 21 lipperhey, hans (um 1570–1619), dt.- niederl brillenmacher u. erfinder 88 locke, john (1632–1704), engl. philosoph loyola, ignatius von (1491–1556), mitbegründer d. 1 jesuitenordens 125 lübeck 47 (a), 53, 55 ludwig ix. (1214–1270), frz. könig 1226–1270) 66
auf einen blick ludwig xiv. (1638–1715), frz. könig (1643– 1715) 132 (a), 138–142, 143 (a), 144, 146–149 150 (a), 151, 153, 155–157, 162 f ludwig xvi. (1754–1793), frz. könig (1774– 1792) 149, 165 f., 178, 182, 186 (a ludwig wilhelm von baden-baden/türkenlouis (1655–1707), markgraf 156 f ludwigsburg (schloss) 138, 144 (a), 145, 156 luther, martin (1483–1546), dt. theologe u kirchenreformator 85, 87 f., 92, 112, 116 (a 117 f., 119 (a), 120–126, 128, 134 lutheraner 112, 113 (k), 125, 129 (k luxuswaren 104, 106; 1 gewürze/ gewürz handel luyken, jan (1649–1712), niederl. künstler m magie (zauberei) 94–97 mainz 60, 82, 84 f malaysia 104 maler(ei) 78 f mangu-khan (1208–1259), mongol. großkhan (1251–1259) 66 f mannheim 156 manufakturen , 153 (a), 154 (k), 167 marie antoinette (1755–1793), frz. königin 1774–1792) 178 markt 42 , 44, 48 (a), 49; ~recht 43 markt- und gewerbeordnungen 44 martin, pierre-denis (1663–1742), frz. maler maximilian i. (1573–1651), kurfürst d. hrr 1623–1651) 128, 132 (a maya 105 medici (kaufmannsfamilie) 91 medizin 31, 86, 159 mekka 103 menschen- und bürgerrechte menschenrechte 173–177, 191 merkantilismus/merkantilistisch , 154 k), 155 mexiko/mexico city 77, 105, 107 (a), 108 michelangelo buonarroti (1475–1564), ital gelehrter 79 mirandola, giovanni pico delle 1463–1494), ital. philosoph 81 missernten 20, 35, 95 missionare/missionierung, christl. 65, 106 mittelaltermarkt (gegenwart) 48 (a), 49 mohammed (um 570–632), begründer d islam 68, 70 molitor, ulrich (um 1442–1507), dt. jurist u hexenhistoriker 97 monarchie 1 konstitutionelle monar chie mönche 30, 31 (a), 32 f., 82, 117 (a mongolen/mongolisches reich 41, 64, 65 k), 66 f mongolensturm 64 , 66 montesquieu, charles louis de secondat 1689–1755), frz. schriftsteller u. philosoph 139, 160, 167 montezuma ii./moctezuma (1502–1519 letzter 1 aztekenherrscher 106, 108 f., 111 müller, charles louis (1815–1892), frz. maler münchen 131 münster 56 (a), 57, 131, 137 münzen/münzgeld 21 f., 43, 54, 90, 118 murschel, anna (um 1533–nach 1600), d 1 hexerei angeklagte frau 98 f muslime 64, 67–69, 70 (a), 71–73, 104, 113 (k n napoléon bonaparte (1769–1821), frz. kaiser (1804–1814/15) 165, 188, 189 (a nationalgarden, frz. 173 nationalkonvent (paris) 178, 180, 184 f., 187 nationalversammlung, frz. 172, 179, 182 ü), 183 naturwissenschaften 31, 79, 83, 86 f., 94 f neubreisach (elsass) 146 (a niederlande 125, 130–132, 191 nomaden 64 nonnen(orden) 30 (a), 31, 62, 117 (a), 124 nordamerika 190, 192; 1 usa o oberster gerichtshof (usa) 193 (ü orient osman i. gazi (ca. 1258–1324/26), begründer d. 1 osmanischen reiches 100 osmanen 76, 100–103 osmanisches reich 100, 101 (k), 112 f osnabrück 131, 137 österreich 65, 92 f., 130, 156, 178 ostfranken 14 ostsee(raum) 53, 131 f otto i. der große (912–973), könig d. ostfränkischen reiches (936–973) u. kaiser d hrr (962–973) 11, 16, 17 (a otto iii. (980–1002), kaiser d. hrr 996–1002) 18 (a), 19 p paizas 66 (a palästina 40 f., 69 , 71, 73 papsttum 12, 110 paris 140 f., 153, 164, 166 f., 172, 173 (a), 178 f 181, 184 f., 195 (a parlament 140 passivbürger 182 (ü patrizier 46, 50 pax mongolica 64–66 pax universalis pest (schwarzer tod , 59, 92 peterhof (kontor in nowgorod) 53 philipp v. (1683–1746), span. könig (1700– 1746) 151 philosophie/philosophen 158–161 phrygische mütze (symbol d. 1 französischen revolution) 173 (a pilger 33 , 69–71, 90, 116 pilgrim fathers (pilgerväter) 190 pisa 70 pius ii. (1458–1464), papst 100 pizarro, francisco (um 1475–1541), span eroberer 77, 105 f., 109 plantage plymouth (siedlung) 190 polen 59, 65 pöllnitz, karl ludwig freiherr von 1692–1775), preuß. schriftsteller 145 portugal 101, 103 f., 106 prager fenstersturz (1618) 130 (a pranger pressefreiheit 185, 188 pressezensur preußen 141, 178 privilegien 26, 43, 54, 58, 60 , 146 147 (ü), 148, 159, 166, 172 f., 178 f., 185 1 schutz privileg protestanten 113, 128, 130–132, 147 protestantische union (1608) 113, 128 ptolemäus (um 100 – um 170), griech astronom 86 (a), 87 puritaner 190 r rastatt 156 f rationalismus , 87 reformation 85, 112, 113 (k), 114–116 118–137 reformierte 113 (k), 125, 128, 129 (k reich 1 heiliges römisches reich reich, röm.-dt. (um 1000) 17 (k reichsacht 1 acht reichsinsignien 15 (a), 16 reichsstädte reichstag , 117, 128 reichstag zu worms (1521) 117, 119 renaissance , 80, 101 republik (staatsform) 178 residenzstädte 156 f revolution revolutionsausschuss (1793) 184 (a revolutionstribunal, frz. 185 rhein 40, 69, 84, 131 f., 146, 148, 157 rheinland 59, 98 rigaud, hyacinthe (1659–1743), frz. maler 150 f rittertum 10, 26 , 28 f., 38, 69 ritualmord 59 (a robert von reims (um 1065–1111), anführer e. 1 kreuzzuges (1096–1099) 71 robespierre, maximilien (1758–1794), frz revolutionär 181, 184 f
register romanik (baustil) 40 rousseau, jean-jacques (1712–1778 schweiz.-frz. philosoph 167 rubruk, wilhelm von (1215/20–um 1270 franziskaner u. forschungsreisender 66 f s sachs, hans (1494–1576), dt. schuh macher u. meistersinger 102 sachsen 124, 128, 134 sachsenspiegel (rechtsbuch d. mittelalters) 16 (a salzmann, christian gotthilf (1744–1811 evang. theologe u. pädagoge 161 sansculotten , 179 (a), 182, 187 schedel, hartmann (1440–1514), humanist u. geschichtsschreiber 84 schedelsche weltchronik 59 (a), 84 schleich, carl (1788–1840), dt. kupferstecher 184 schmalkaldischer krieg (1546/47) 128 schoen, erhard (um 1491–1542), dt. zeichner 119, 124 schreckensherrschaft/la terreur (1 fran zösische revolution) 165, 179, 184 f., 188 schutzprivileg, jüd. 58, 60 (a schwarzer tod 1 pest schweden 130–132 schweiz 131 schwertleite 28 (a seefahrer/seefahrt, europ. 104–107 seeweg nach indien 101, 104 seide 65, 67 (a), 101 seidenstraße 65 selbstverwaltung (mittelalterl. stadt) 46 self-government (selbstverwaltung) 190 setzkasten (buchdruck) 82 siedler 105, 190 sixtinische kapelle (vatikan) 79 (a slawen 69 smith, adam (1723–1790), schott. wirtschaftswissenschaftler 155 söldner , 133 (a sonnenkönig 1 ludwig xiv spanien 101, 104, 106, 130, 190 f spätmittelalter 57 (a), 95, 116, 118 (a), 120 spee, friedrich (1591–1635), dt. theologe u jesuitenpater 97 speyer 58, 60 stadt 12, 35, 40 f , 43 (a), 44, 45 (a), 46 f 50 f., 58 f.; ~herr(schaft) 46 f.; ~rat 40 f., 46 50, 59; ~recht 53; ~siegel 47 (a städte, europ. (13. jh.) 11 (k stadtluft macht frei 46 stalhof (kontor in london) 53 stamp act (1764) 192 ständegesellschaft, frz. 147 (ü), 149, 171 194 (a ständeordnung a), 23 (a), 79, 81 (a stehendes heer 146 steuern 46, 59, 106, 120–122, 134, 143, 147 ü), 148, 153, 155, 166–170, 188, 190, 192 straßburg 51, 61, 146, 148 stuttgart 144 sultan , 102 f synagoge , 59 t tenochtitlan 105, 108 (a territorialstaat k), 135 (k territorium teufelspakt/teufelsbuhlschaft 94, 96 (a textilien/textilherstellung 90, 106 these thesen (1 luther 1517) 112, 117 f toleranzedikt (nantes 1598) 138 treueid 16 türkengefahr/türkenfurcht 100, 102 twain, mark (1835–1910), us-amerik schrift steller 85 u unabhängigkeitserklärung, amerikanische , 192 f.; 1 4. juli 1776 unabhängigkeitskrieg, amerik 1775–1781) 191 unfreie 20 f., 34 ungarn 66 un-menschenrechtserklärung (1948) 176 untervasallen 15; 1 vasallen urban ii. (1088–1099), papst 69, 71, 75 (a urban viii. (1623–1644), papst 132 (a usa 125, 164, 176, 191 (k), 193 (ü); 1 amerika v vasallen 15 f., 134 vauban, sébastien le prestre de 1633–1707), frz. offizier u. ingenieur 155 vegetation (900–1300) 41 (k venedig 70, 101 verfassung (frankreich 1791) 178, 182 (ü 183 f verfassung verleger 90 vernet, claude-joseph (1714–1789), frz maler 152 versailles (schlossanlage b. paris) 138 (a 140, 141 (a), 144, 151 f., 157, 166–168, 172 f vesalius, andreas (1514–1564), fläm. anatom 86, 89 vespucci, amerigo (1451–1512), ital. seefahrer 105 volkssouveränität 159, 191 voltaire/françois marie arouet 1694–1778), frz. schriftsteller u. philosoph 159 (a), 167 vrancx, sebastian (1573–1647), fläm. maler w wahlen, us-amerik. 193 (ü wahlrecht 172, 182 f.; ~, frz. 182 (ü), 183, 188 waren(handel) 21, 42, 44, 48, 50, 52–54, 65 91, 101, 104, 106–108, 120, 152, 154 f., 167, 190 washington, george (1732–1799), erster präsident der usa (1789–1797) 191 webstuhl, mechan. 168; 1 textilindustrie wechsel/wechselbrief weltbilder 77, 78, 86–88, 89 (a); 1 geozentrisches/heliozentrisches weltbild welthandel 1 handel westfälischer frieden 113, 131, 134, 137 westfranken 14 weströmisches reich (westrom) 12 wick, johann jakob (1522–1588), schweiz geistlicher 95 wickiana (nachrichtensammlung d. 16. jh 95 (a), 96 (a widukind von corvey (um 925–nach 973 sächs. geschichtsschreiber 16 wirtschaft, frz. 1 merkantilismus wohlfahrtsausschuss 184 wright, joseph, maler (1794–1877), engl maler 158 württemberg 134 (k), 144 z zensuswahlrecht 182 (ü), 183 zentralperspektive 79 zentren, geistl. (13. jh.) 11 (k zinsen 58, 61 zölle 44, 53, 59 f., 101, 103, 152 f., 155, 190 zunft 41, 50 f., 58, 61 f.; ~ordnung 50 f.; ~zeichen 50 (a zunftzwang zweiter stand 1 klerus zwölf artikel d. memminger bauern (1525
auf einen blick bildquellennachweis umschlag istockphoto iñaki antoñana plaza calgary alberta 10.d1 bildarchiv rodrun robert knöll rodrun/c.knöll altenriet 13.q1 ullstein bild gmbh imagebroker/daniel schoenen berlin 13.q2 akg-images berlin 15.q1 a; 15.q1 d akg-images berlin 15.q1 b alamy images insadco photography/ willfried gredler abingdon oxon 15.q1 e; 15.q1c mauritius images united archives mittenwald 16.q2 a; 16.q2 c herzog august bibliothek cod guelf aug° folio 53r wolfenbüttel 16.q2 b bpk berlin 17.d2 by zdf und jan prillwitz 18.q1 akg-images berlin 21.q1 bpk berlin 22.q3 akg-images berlin 23.q6 ullstein bild gmbh iberfoto berlin 27.q1 by kniesel user:-donaldlauffen own work cc by-sa de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en gfdl http:// www.gnu.org/copyleft/fdl.html or cc-by-sa-3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ via wikimedia commons 28.q2 bibliothèque nationale de france paris 30.q1 akg-images berlin 31.q2 akg-images berlin 34.d1 fanny hartmann aus norbert wand das dorf der salierzeit ein lebensbild 1991 jan thorbecke verlag sigmaringen 36.q2 akg-images album berlin 36.q3 akg-images british library berlin 37.q4 akg-images british library berlin 37.q5 akg-images berlin 39.q2 ullstein bild gmbh archiv gerstenberg berlin 40.d1 picture-alliance dpa/peter steffen frankfurt 45.q4 a picture-alliance dpa frankfurt 45.q4 b mauritius images alamy mittenwald 45.q4 c picturealliance dumont frankfurt 45.q4 d ropi pressefoto bildarchiv antonio pisacreta freiburg 46.q1 akg-images berlin 46.q2 herzog anton ulrich-museum braunschweig kunstmuseum des landes niedersachsen museumsfotograf 47.q3 archiv der hansestadt lübeck lübeck 47.q4 vorlage stadtarchiv freiburg 47.q5 rheinisches bildarchiv köln rba 48.d1 langen georg köln 49.d4 langen georg köln 50.q1 photo scala 50012 bagno ripoli firenze 51.q3 stuttgart württembergische landesbibliothek cod poet et phil fol bl 203r 53.q1 akg-images berlin 55.d3 akg-images berlin 56.q1 fotolia.com eyewave new york 57.q2 österreichische nationalbibliothek wien 59.q1; 59.q2 akg-images berlin 60.q3 akg-images berlin 61.q5 staatsund universitätsbibliothek hamburg cod hebr 27r 62.q1 khm-museumsverband wien 63.q2 bpk berlin 63.q3 det kongelige bibliothek kopenhagen 64.q1 akg-images roland and sabrina michaud berlin 66.q3 akg-images berlin 67.q6 bridgemanimages.com berlin 68.d1 thinkstock peter spiro münchen 70.q1 akg-images british library berlin 72.q6 edinburgh university library chronology of ancient nations f.134v 1307 al-biruni or.ms.161 edinburgh eh8 9lj 75.q1 interfoto bildarchiv hansmann münchen 75.q2 akg-images berlin 76.d1 fh bielefeld horst langer produktentwicklung 79.q1 artothek joseph martin weilheim 80.q2 akg-images bildarchiv monheim berlin 80.q3 akg-images berlin 81.q5 foto jürgen vogel lvr landesmuseum bonn 84.q2 reuters lee jae-won frankfurt 84.q3 akg-images berlin 85.q6 www cartoonstock.com joseph farris bath 86.q1 bpk deutsches historisches museum/sebastian ahlers berlin 88.q3 akg-images berlin 89.q5 nasa washington d.c 89.q6 bpk staatsbibliothek zu berlin berlin 92.q1 akg-images berlin 93.q4 akg-images british library berlin 95.q1 zentralbibliothek zürich signatur ms 147v zürich 96.q2 bpk berlin 97.q6 getty images de agostini münchen 99.q2 mauritius images alamy/ michael liebrecht mittenwald 102.q2 ullstein bild gmbh berlin 106.q1 akg-images berlin 107.q2 akg-images album berlin 108.d2 corbis charles josette lenars berlin 110.q1 www.cartoonstock.com dan reynolds bath 111.q2 corbis jorge silva berlin 112 d1 buchstabenschubser potsdam 116.q1 akg-images berlin 117.q2 sub göttingen cod ms theol cim fol 35r 118.q3 bayerisches nationalmuseum inv.-nr ma 3351 münchen 119.q7 ullstein bild gmbh berlin 120.q1 akg-images berlin 123.q6 interfoto toni schneiders münchen 124.q1 akg-images berlin 127.q5 bpk berlin 128.q1 cc-by-sa-4.0 oren neu dag talk/keine änderungen lizenzbestimmungen zu cc-by-sa-4.0 siehe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/ mountain view 130.q1 bpk knud petersen berlin 132.q2 interfoto bildarchiv hansmann münchen 133.q5 akg-images berlin 136.q1 bpk berlin 137.q4 akg-images berlin 138.d1 akg-images marc deville berlin 141.q1 akg-images berlin 143.q3; 143.q4 akg-images berlin 144.d1 nürnberger luftbild nürnberg 146.d1 re. laif hemis fr/bertrand rieger köln 148.q3 schröter wolfgang markkleeberg 149.q6 interfoto photoaisa münchen 150.q1 bpk rmn/blot berlin 152.q1 akg-images erich lessing berlin 153.q2 akg-images berlin 156.q1 akg-images berlin 158.q1 akg-images berlin 159.q2 akgimages berlin 161.q6 süddeutsche zeitung photo scherl münchen 163.q2 akg-images bildarchiv monheim berlin 164.d1 ddp images gmbh jadis hamburg szenenbild aus dem film die französische revolution regie robert enrico richard heffron u.a mit jane seymour christopher lee 167.q1 bpk berlin 168.q2 bridgemanimages.com giraudon berlin 170.q1 akg-images berlin 172.q1 akgimages berlin 173.q2 akg-images berlin 174.q3 akg-images berlin 176.q1 böthling jörg/visualindia.de hamburg 178.q1 bpk rmn/bulloz berlin 179.q2 li. akg-images berlin 179.q2 re. bridgemanimages com berlin 180.q3 akg-images berlin 184.q1 corbis berlin 185.q2 ullstein bild gmbh archiv gerstenberg berlin 186.q3 akg-images erich lessing berlin 189.q1 akg-images berlin 190.q1 akgimages quint lox berlin 194.q1 ullsteinbildgmbh(rogerviollet),berlin *3 lizenzbestimmungen zu cc-by-sa-4.0 siehe: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/ sollte es in einem einzelfall nicht gelungen sein, den korrekten rechteinhaber ausfindig zu machen, so werden berechtigte ansprüche selbstverständlich im rahmen der üblichen regelungen abgegolten.
mit geschichte und geschehen erfährst du in jedem kapitel warum geschichte dich betrifft erarbeitest du dir themen selbstständig oder im team erwirbst du schritt für schritt kompetenzen helfen dir denkanstöße beim lösen von aufgaben fordern dich besonders knifflige aufgaben zum weiterdenken kannst du erlerntes überprüfen und trainieren
Video
Audio
Bild
Aktuelles
Lesezeichen
Dokument
Anwendung
Einstellungen
Keine Zugangsdaten für automatisches Login hinterlegt.
Anmeldung
Achtung
Es besteht keine Verbindung zum Internet. Ihre Notizen und Anmerkungen werden offline gespeichert. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt synchronisiert
Bei Fragen wenden Sie sich an [email protected].
Hilfe
A. Startseite
Die Startseite des eBook erkennst du immer daran, dass du das zugeklappte Schulbuch mit der Titelseite vor dir siehst.
B. Zugangsmöglichkeiten zum Buch
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich im Schulbuch zu bewegen:
– Mit den einfachen Pfeilen gelangst du jeweils eine Seite vor und zurück.
– Durch Klick auf die Seitenzahl in der Mitte unten öffnest du einen Slider, mit dem du dich durch das Buch bewegen kannst. Per Klick auf die jeweilige Seite rufst du diese auf.
– Durch einen erneuten Klick auf die Seitenzahl wird das Textfeld mit den Seitenzahlen aktiv und du kannst hier direkt deine gewünschte Seite angeben.
– Per Klick auf das Haus-Symbol springst du auf die Startseite.
Außerdem gibt es stellenweise interne Verlinkungen, wie z. B. im Inhaltsverzeichnis oder bei Verweisen auf Anhänge im hinteren Teil des Buches. Folgt man einem solchen Link, so wird auf der Zielseite unten links neben der Seitenzahlanzeige ein orangefarbenes Symbol eingeblendet, über das man zurück zur Ausgangsseite gelangt.
C. Vergrößerung des Buchs
Du kannst dir jeden beliebigen Ausschnitt auf der Schulbuch-Seite heranzoomen:
– Bewege am Computer die Maus an die entsprechende Stelle im Schulbuch und drehe am Mausrad.
– Nutze am Whiteboard den Schieberegler in der Navigationsleiste.
– Am Tablet kannst du in die Seiten mit Daumen und Zeigefinger hinein- und hinauszoomen.
II. Effizient arbeiten: Passgenaue Materialien und Informationen
Das eBook pro zeigt dir zu vielen Seiten des Schulbuchs passgenaue Materialien und Informationen an.
A. Informationen und Materialien passend auf der Seite
Es gibt zu verschiedenen Themen Zusatzinformationen und Materialien, die direkt auf der Seite aufgerufen werden können. Das können sein: Videos, Audios oder interaktive Übungen. Du siehst an den farbigen Icons, ob es auf der aufgeschlagenen Seite Inhalte für den jeweiligen Bereich gibt. Klickst du auf das Symbol, so öffnet sich ein Fenster mit zusätzlichem Material.
B. Eigene Materialien
Der Menüpunkt „Eigene Materialien“ gibt dir die Möglichkeit, auf Zusatzmaterialien im Internet zu verlinken. Bitte beachte, dass du nur bei bestehender Internetverbindung Zugriff auf die hinterlegten Webseiten hast.
III. Fokussieren: Der Einsatz des eBook pro
Das eBook pro unterstützt dich auf vielfältige Weise. Nutze die interaktiven Inhalte, den Fokus und die Abdecken-Funktion.
A. Vollbildansicht
Die Vollbildansicht aktivierst du durch Klick auf das entsprechende Symbol in der unteren grauen Leiste. Genauso deaktivierst du diese auch wieder.
B. Schulbuch interaktiv / Schulbuch pur
Im eBook pro sind die direkt nutzbaren Begleitmedien – Videos, Audios, interaktive Übungen – auf der Seite selbst eingeblendet. An den farbigen Symbolen erkennst du gleich, um welche Art Material es sich handelt. Wenn du auf das Symbol klickst, wird das Material sofort geöffnet oder abgespielt. Du kannst übrigens auch alle diese Symbole ausblenden, wenn du lediglich das reine Schulbuch verwenden willst. Klicke dazu auf das Schaltfeld "Schulbuch pur" in der grauen Palette "Darstellung". Die Schaltfläche ändert sich in "Schulbuch interaktiv". Wenn du dann alle Symbole wieder einblenden möchtest, einfach wieder auf dieses Schaltfeld klicken.
C. Abdecken und Fokus
Mit einem Klick auf das dunkelgraue Symbol für "Abdecken" kannst du das Schulbuch und sämtliche Inhalte mit einer grauen Fläche überdecken. Klicke erneut auf dasselbe Symbol, um sämtliche Inhalte wieder einzublenden. Für die Konzentration auf einen Text, ein Bild oder eine Aufgabe des Schulbuchs kannst du den Fokus einschalten. Klicke zuerst auf das Fokus-Symbol in der Palette. Der Cursor verändert sich zu einem Kreuz. Mit der Maus oder der Zeige-Funktion am Whiteboard kannst du nun einen Rahmen genau um den Inhalt herum aufziehen, der sichtbar bleiben soll. Dieser Rahmen kann danach noch verschoben oder in der Größe angepasst werden. Zum Schließen des Fokus klickst du wieder auf dasselbe Symbol.
IV. Hervorheben und kommentieren: Notizen, Markierungen, Links, Lesezeichen
Du hast im eBook pro die Möglichkeit, Markierungen und Notizen anzubringen. Mit dem Aus- und An-Schalter auf der linken Seite in der unteren Navigation kannst du deine Notizen ein- oder ausblenden. Die Palette Notizen wird automatisch auf "Ein" geschaltet, wenn der Stift, der Marker oder der Notizzettel angeklickt werden. Mit Klick auf "Aus" werden Markierungen und Notizen wieder ausgeblendet.
A. Stift, Textmarker, Löschen-Werkzeug
Mit dem Stift und dem Marker kannst du direkt Notizen auf dem Buch anbringen. Um eine Zeichnung oder Markierung zu löschen, nutzt du den Pfeil, um die entsprechende Anmerkung zu aktivieren.
B. Notizzettel, Link auf Internet-Adressen
Die Funktion Notizzettel ermöglicht es, über die Tastatur längere Bemerkungen anzubringen. Der Notizzettel kann auch ausgedruckt und gelöscht werden. Auch in Notizzetteln hast du die Möglichkeit auf Zusatzmaterialien im Internet zu verlinken. Bitte beachte, dass du nur bei bestehender Internetverbindung Zugriff auf die hinterlegten Webseiten hast.
C. Lesezeichen
In der Palette Notizen kannst du die Lesezeichen-Funktion aufrufen. Um ein Lesezeichen anzulegen, wechselst du im Lesezeichen-Fenster durch Klick auf das Stift-Symbol in den Editiermodus. Es lassen sich beliebig viele Lesezeichen im Schulbuch anbringen und mit einem Kommentar versehen.
V. Gezielt im Buch suchen
Suchst du nach einem bestimmten Begriff im Buch, so gibst du ein entsprechendes Stichwort in das Suchfeld rechts oben ein. Du erhältst die Seiten und Materialien im Buch, in denen das Wort vorkommt, und gelangst per Klick direkt auf die entsprechenden Seiten. Den Begriff, nach dem du gesucht hast, siehst du auf der jeweiligen Seite farblich unterlegt.
VI. Nutzer-Schlüssel einlösen
In „Mein Klett“ kannst du unter „Mein Klett-Arbeitsplatz“ Nutzer-Schlüssel deiner digitalen Klett-Produkte einlösen. Ein Nutzer-Schlüssel ist ein Zahlencode, er kann z. B. so aussehen: xhZ7-59kH-D35U. Nach der Eingabe des Nutzer-Schlüssels hast du deine Online-Version erfolgreich freigeschaltet. Jetzt kannst du die Online-Version der Software nutzen und nach Eingabe deiner Klett-Benutzerdaten von jedem Rechner aus bei bestehender Internetverbindung deine Anmerkungen und Notizen abrufen.
Impressum
Ernst Klett Verlag GmbH
Rotebühlstraße 77
70178 Stuttgart
Telefon: +49 711 6672-1163
E-Mail: [email protected]
Handelsregister: Stuttgart HRB 10746
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 811122363
Verleger: Dr. h. c. Michael Klett
Geschäftsführung: Dr. Angela Bleisteiner, Tilo Knoche (Vorsitz), Ulrich Pokern
Ansprechpartner: Lars Pennig
Redaktion: Carsten Loth, Jana Schumann
Mediengestaltung: Kerstin Heisch
Screendesign: Kochan & Partner GmbH, München;
Software-Entwicklung: 1000° DIGITAL GmbH, Leipzig
© 2016
Alle Rechte vorbehalten
www.klett.de
Hinweis zum Urheberrechtsgesetz: Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen oder in den Lizenzbedingungen dieses Produktes genannten Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Hinweis zu § 52 a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung gespeichert und in ein Netzwerk eingestellt werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen und Hinweise zum Datenschutz.
Datenschutz
Hallo in der Demoversion deines eBook pro,
hier findest du dein Schulbuch und viele Zusatzmaterialien- Videos, Audio-Elemente, interaktive Übungen.
Ě Hilfen, um den Lernstoff besser zu VERSTEHEN.
ė ÜBEN, um den Lernstoff zu trainieren.
Í Mit der SUCHE findest du alle Inhalte.
Datenschutz
Nutzergenerierte Daten, wie z.B. die Synchronisierung von Notizen und Anmerkungen, werden zum späteren Online-Aufruf auf einen zentralen Klett-Server übertragen. Die Daten sind auf einem nach aktuellem Stand der Technik sicheren Server bei einem deutschen Hosting-Anbieter abgelegt. Es greift das bundesdeutsche Datenschutzgesetz.
Die nutzergenerierten Daten können nur vom Nutzer selbst aufgerufen werden.
Die personenbezogenen Daten werden nur zum Zwecke der Erfüllung der angebotenen Dienste genutzt.
Die Ernst Klett Verlag GmbH als Betreiberin des Online-Angebots stellt sicher, dass keine Nutzerdaten an Dritte weitergegeben, verkauft oder für andere Zwecke als im Rahmen des Online-Services "Digitaler Unterrichtsassistent" verwendet werden.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen und Hinweise zum Datenschutz.
Quellen
Alle Quellenangaben finden sich direkt in den Materialien, z. B. in der Fußzeile der Dokumente.
Drittanbieter-Lizenzen
node-webkit: credits.html (Offline-Version)
Alle Warenzeichen, Marken, Firmennamen usw. und die damit zusammenhängenden Rechte gehören dem jeweiligen Rechteinhaber.
Quellenverzeichnis
Geschichte und Geschehen Baden-Württemberg 7
Die Autoren sind im blätterbaren Buch auf Seite 2 genannt, die Bildquellen auf S. 232
Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf den Verwendungsort in der Schülerbuchlektion.
Achtung